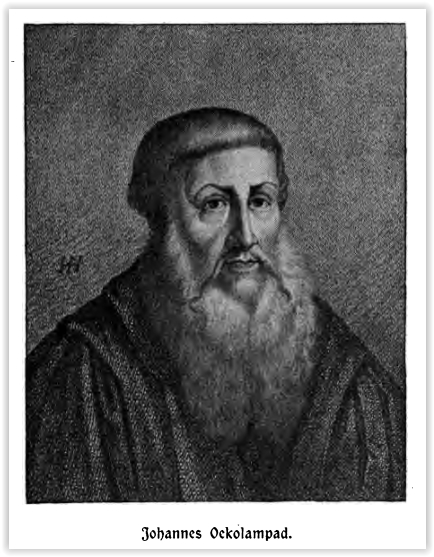Matthias Zell

Es wurde einst dem berühmten Münsterprediger Geiler ein junger Knabe aus Kaysersberg vorgestellt. Geiler unterhielt sich liebreich mit ihm, stellte an ihn einige Fragen und wurde durch die treffenden Antworten und das geistvolle Wesen des Knaben dermaßen erfreut, dass er… WeiterlesenMatthias Zell