Johannes Oekolampad
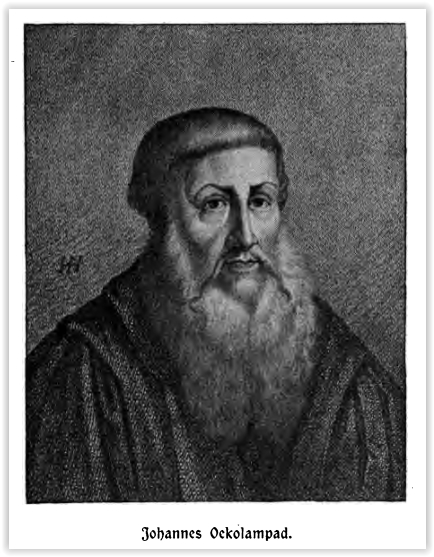
Eine kurze Erzählung des Lebens und Todes Johannes Ökolampads. Indem ich wieder der reformirten Kirche eine Auswahl von Schriftwerken eines ihrer Reformatoren biete, will ich in kurzen Zügen erzählen, wer der Gottesmann gewesen, dessen Schriftwerk der christliche Leser hier vor… WeiterlesenJohannes Oekolampad