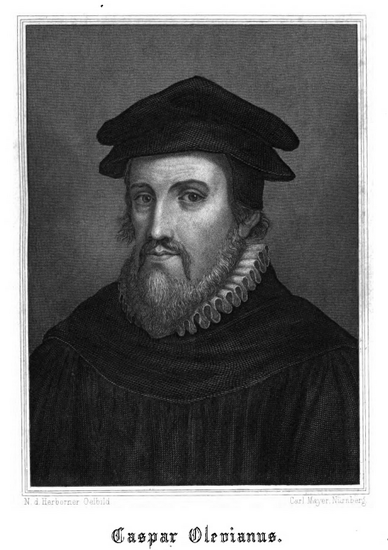Als in der zweiten Hälfte des siebzehnten Jahrhunderts Frankreich – wie Ranke es nennt – seinen Welttag erlebte und in fast allen Zweigen menschlicher Thätigkeit Geister ersten Ranges den Ruhm der Regierung Ludwigs XIV. verherrlichten, da blühte auch die Kanzelberedsamkeit auf: Bossuet, Bourdaloue und Massillon in der römischen und Saurin in der reformirten Kirche glänzen noch immer als Sterne erster Größe in der Geschichte der französischen Literatur. Das achtzehnte Jahrhundert, das Jahrhundert der Aufklärung und des Unglaubens, kann jenen großen Rednern keine ebenbürtige Namen an die Seite stellen; erst in unserm Jahrhundert hat Frankreich in beiden Kirchengemeinschaften wieder Kanzelredner aufzuweisen, deren man weit über die Gränzen ihres Vaterlandes hinaus mit Ruhm und Verehrung gedenkt. Die römische Kirche zählt namentlich Lacordaire zu ihren größten Rednern, und er verdient diese Auszeichnung, obgleich die Fehler seines Volkes, die zugleich nicht selten auch Fehler seiner Kirche sind, nämlich der blendende Prunk, die Effekthascherei, die Ueberredung durch Einwirkung auf das Gefühl und die Phantasie, wo die Belehrung durch überzeugende Gründe und helle, klare Stellen des göttlichen Wortes an der Stelle wäre, obgleich diese Fehler, sage ich, gerade in vielen seiner gepriesensten Reden die wahre Erbauung wesentlich verkümmern. Während Männer wie Bossuet und Lacordaire weit mehr hinreißen, entzücken, aufregen und blenden, als erheben, kräftigen, belehren und erbauen, und ihre glänzendsten Eigenschaften besonders da hervortreten, wo sie ihre Kirche verherrlichen: verschmähen es die größten evangelischen Kanzelredner Frankreichs oder der französischen Zunge der Neuzeit, Vinet und Adolf Monod, das Evangelium durch äußeren Flitter gleichsam zu schmücken; sie verkünden die Heilslehre, des Menschen Elend und Gottes Erbarmen, sie predigen Christum den Gekreuzigten, führen den Beweis des Geistes und der Kraft, und in der gewissen Zuversicht, daß das Evangelium eine Kraft Gottes ist, selig zu machen Alle, die daran glauben, stellen sie sich in den Dienst des einfach großen Evangeliums also, daß sie in selbstverleugnender Demuth ihre eigne Persönlichkeit ganz zurücktreten lassen und im schönsten Sinne des Wortes nichts wissen als Jesum den Gekreuzigten. Adolf Monod liegt der Gedanke ganz fern, in seinen Reden Muster der Kanzelberedsamkeit, oratorische Meisterstücke geben zu wollen, er will seinem Heiland Seelen gewinnen, will selbst aber nichts gelten und nichts sein, und gewinnt grade durch diese Demuth seiner Gesinnung, durch diese Lauterkeit und diese Inbrunst seines Strebens seine Zuhörer und Leser, wird gerade dadurch wider Wissen und Willen der gewaltige Redner, dessen Namen die evangelische Christenheit nicht mit kalter Bewunderung, sondern mit Liebe und Verehrung nennt.
Sprechen wir jedoch zuerst von A. Monods äußern Lebensverhältnissen. Leider sehen wir uns noch immer auf die wenigen Notizen, die sich in verschiedenen Blättern finden, angewiesen; die Familie des Verewigten bereitet jedoch jetzt die Herausgabe eines ziemlich umfangreichen Buches vor, welches außer wichtigen Briefen die Lebensgeschichte Monods enthalten wird.
Monod wurde am 21. Januar 1802 zu Kopenhagen, wo sein Vater, Jean Monod, Pfarrer der französischen Gemeinde war, als der vierte Sohn einer Familie, die zwölf Kinder zählte, geboren; seit dem Jahre 1808, also im Alter von sechs Jahren, wurde der Knabe, als der Vater zum Prediger in Paris ernannt wurde, auf französischen Boden verpflanzt. Der würdige Vater und die gleich vortreffliche Mutter, eine geborene de Conind aus Kopenhagen, erzogen ihre Kinder mit der größten Sorgfalt; sie hatten die Freude, daß sich unter ihren acht talentvollen Söhnen vier aus voller Neigung dem evangelischen Pfarramte widmeten. Nachdem A. Monod seine Gymnasialbildung im College Bonaparte zu Paris erhalten hatte, begab er sich nach Genf, um sich mehrere Jahre philosophischen und theologischen Studien zu widmen. Er war einer von den sechs Studirenden, die sich hier damals ganz besonders für die zerstreuten Glaubensgenossen in Italien interessirten. Nachdem er daher seine Studien in Genf beendigt hatte, begab er sich im Jahre 1825 mit seinem Bruder Wilhelm nach Italien und gründete in Neapel die evangelische Gemeinde, während der Bruder Wilhelm den Grund zu der evangelischen Gemeinde in Florenz legte. Der Aufenthalt in Neapel, wo er fünfzehn Monate verweilte, war für Monods innere Entwicklung von großer Bedeutung. Der zur Zeit seiner Universitätsstudien allgemein herrschende Rationalismus befriedigte ihn schon lange nicht mehr; im täglichen Verkehr mit dem einem todten Werkdienste und einem halbheidnischen Cultus ergebenen neapolitanischen Volke lebte er sich immer tiefer ein in die frohe Botschaft von der Rettung des sündigen verlorenen Menschen durch Jesum Christum, den Heiland der Welt. Nun hatte er Glauben und damit für sich den festen Lebensgrund und zugleich den Inhalt für seine Predigten gefunden: die zwei herrlichen Reden „des Menschen Elend“ und „Gottes Erbarmen“, die sich in der ersten Lieferung dieser Sammlung finden, sind der lebendige Ausdruck seiner nun ganz im Evangelium eingewurzelten Ueberzeugung. „Ich habe nie einen jungen Mann gekannt“, sagt der Bruder Wilhelm Monod, „der seine Studien mit einem solchen Feuer ergriff und ein so glühendes Verlangen nach Vollendung besaß. Das ernsteste Streben seiner Jugend war das Suchen nach Wahrheit, das Forschen nach dem Heilswege des Menschen. Jahre lang war seine Seele wie versunken in dem Forschen nach dieser Wahrheit aller Wahrheiten, bis er nach schwerem Ringen zu jenem Glauben gelangte, der seiner Seele Frieden und Freude gab, daß nämlich der aus freier Gnade gerettete Sünder durch den Glauben an Jesum Christum selig werde. Sobald diese Ueberzeugung in ihm feststand, seines Lebens Leben geworden war, nahm sein Geist einen neuen Aufschwung, wurde sein Wort ein Licht in der Kirche. Und dieser Glaube zwängte seinen Geist nicht ein, sondern gab ihm erst volle Freiheit und Stärke, gab seiner Predigt Fülle des Inhalts, Salbung und Gewalt.“ Während Vallette, der Freund und Studiengenosse A. Monods in Genf, als evangelischer Prediger nach Neapel ging, kehrte Monod nach Frankreich zurück und wurde als Pastor in Lyon angestellt.
Hier erwarteten ihn heftige Kämpfe. Der junge eifrige Prediger, der das Licht, welches ihm selber erst vor kurzem aufgegangen war, gern in alle Welt getragen hätte, gerieth mit dem rationalistischen Consistorium zu Lyon und manchen Gemeindemitgliedern in Zwiespalt; die Predigt vom Gekreuzigten, von der Sündhaftigkeit und Erlösungsbedürftigkeit des Menschen galt ihnen für Pietismus und Mysticismus. Man wünschte ihn zu beseitigen und wartete nur auf eine Gelegenheit, dies Vorhaben auf schickliche Weise ausführen zu können. Diese Gelegenheit fand sich, als Monod gegen den Leichtsinn, mit welchem Manche ohne Reue und Buße sich dem Tische des Herrn nahten, in einer die Fehlenden allerdings mehr abstoßenden als gewinnenden Weise in der Predigt: „Qui doit communier?“ sich aussprach. Das Consistorium verklagte den jungen, eifrigen Prediger beim katholischen Cultusminister, und Adolf Monod ward seiner Stelle entsetzt. Er war aber nicht gewillt, seinen Gegnern das Feld zu räumen; verschloß sich ihm die öffentliche Kirche, so öffnete sich ihm ein Saal, ja bald, da die Zahl seiner Anhänger sich rasch vermehrte, eine geräumige Kapelle. „Dreißig Jahre sind seitdem verflossen; und heute ist die evangelische Kirche in Lyon eine zahlreiche lebendige Gemeinde mit vier Pastoren, mehren Evangelisten und acht Kapellen, in welchen den arbeitenden Klassen in und um Lyon das Evangelium gepredigt wird. So veranlaßte das Consistorium, ohne es zu wissen und zu wollen, dies so sehr gesegnete Werk Adolf Monods.“ (Bonnet.)
Erst 1836 erlangte der Verkannte auch von der Regierung einen Beweis der Anerkennung seines Strebens; in diesem Jahre wurde er zum Professor in Montauban ernannt. Mit wie großem Eifer er hier sich auch den gelehrten Studien hingab, er blieb doch auch in Montauban dem Berufe treu, für welchen ihn Neigung und außerordentliche Begabung bestimmten; er predigte freiwillig jeden Sonntag, selbst seine Ferien benutzte er, um den im südlichen Frankreich zerstreuten kleineren und größeren evangelischen Gemeinden das Evangelium zu verkündigen. Monods Ruhm als Kanzelredner war bald so allgemein in Frankreich anerkannt, daß die öffentliche Stimme ihm seinen Platz auf der ersten protestantischen Kanzel Frankreichs anwies. Im Jahr 1847 wurde er als Adjunkt des Pastors Juillerat nach Paris berufen und im Jahre 1849 als wirklicher Pastor der reformirten Kirche von Paris angestellt; neun Jahre lang hat er dann noch in der Hauptstadt Frankreichs dies Amt verwaltet. Er predigte aber nicht blos in der Hauptkirche, dem Oratoire, sondern auch im Panthémont und andern evangelischen Kirchen von Paris; ja er predigte oft schon in aller Frühe des Sonntags den evangelischen Schülern der höheren Lehranstalten, und jeden Sonntag Abend hielt er noch im Oratoire eine Bibelstunde, die wegen der reichen Belehrung und Erbauung, welche sie bot, sehr fleißig besucht war.
Adolf Monod war ein von Natur reich begabter Mensch, und seine herrlichen Anlagen waren durch eine musterhafte Erziehung und treuen Fleiß auf’s schönste entwickelt worden. Mit klarem Verstande verband sich lebhafte Phantasie und tiefes Gemüth; der Umfang seiner Kenntnisse war sehr bedeutend, denn seine Studien umfaßten nicht blos die ihm zunächst liegenden Fächer der Philosophie und Theologie, sondern auch die französische, englische und deutsche Literatur; mit der deutschen Theologie zumal ging er stets weiter. Standen diese großen Fähigkeiten und umfassenden Kenntnisse allein, so würde Monod ein Schönredner und Modeprediger geworden sein, nie aber hätte er dieser die Tiefen des menschlichen Herzens erfassende, das Gemüth in Reue und Buße niederbeugende und in Glaube, Hoffnung und Liebe aufrichtende Verkündiger des Evangeliums werden können, wenn nicht seine Rede der einfache und zugleich tief ergreifende Erguß seines christlichen Charakters gewesen wäre. Er hatte seine schönen Naturgaben am Fuße des Kreuzes auf Golgatha seinem Erlöser zum Opfer gebracht und sie dann geläutert und geheiligt zurückerhalten. Ihm war das zeitliche und ewige Heil Aller, die ihn hörten, Herzenssache; er klagte um jede sich verirrende, und frohlockte um jede wiedergewonnene Seele. Er hatte es im eigenen Leben erfahren, wie Christus allein der dürstenden Seele jenes Wasser des Lebens reicht, nach welchem uns nimmermehr dürstet; auf diese Weise sah er es schon als die heiligste Pflicht der Dankbarkeit an, dies Heil einfach und lauter Allen anzubieten, die Sehnsucht nach diesem Heil durch Bloßlegung der verborgensten Seelenzustände des natürlichen Menschen zu erwecken und das Verlangen der mühseligen und beladenen Seele nach Trost und Frieden durch die Verkündigung des Evangeliums der Gnade zu stillen. Ueberall fühlt man es seinen Worten an, es ist Alles erfahren und erlebt. Nirgends trockene Dogmatik, todte Orthodoxie, überall der warme Hauch des aus dem wiedergeborenen Herzen hervorquillenden Lebens. Und aus der Quelle dieses Lebens, aus dem Glauben an den erbarmenden Gott und Jesum Christum, den Heiland der Welt, hatte er die Stärke und Lebendigkeit seiner Ueberzeugung, die glühende Liebe zu seinen Brüdern, die Treue in seinem Amte geschöpft. Sein Glaube war nicht ein todtes aus Glaubensbekenntnissen überkommenes Fürwahrhalten, sondern Geist und Leben, das Leben seines Lebens. Wenige Tage vor seinem Tode, als er in der Ueberzeugung, sein letzter Augenblick sei nahe, den Seinigen sein letztes Lebewohl zugerufen und ihnen seinen Segen gegeben hatte, sprach er: „Mein ganzes Amt, alle meine Werke, alle meine Predigten, alles erscheint mir jetzt wie ein unreines Gewand; ein Tropfen von Christi Blut ist mir weit köstlicher.“ Und wie einfältig war dieser Glaube! Er, der sein Lebenlang gearbeitet, gelernt, gedacht, geforscht hatte und in seinem wissenschaftlichen Erkennen stets gewachsen war, faßte das Ergebniß seiner Studien und Arbeiten kurz vor seinem Tode in die wenigen Worte zusammen: „Ich danke Gott, daß er mir den Glauben eines kleinen Kindes gegeben hat.“ Und wie lebendig war dieser Glaube! Als am 6. Oktober 1855 seine eilf Geschwister und die andern Familienmitglieder an seinem Bette sich versammelt hatten, faßte er Alles, was ihm das Leben, sein Amt und sein langes Leiden gelehrt hatten, in die Worte zusammen: „Christum wissen macht nicht heilig und nicht selig, sondern Christum haben. Es gibt kein anderes christliches Leben als das Leben Christi, als Christus in uns, wie es auch kein anderes Heil gibt als die Gegenwart Christi in uns.“ So fest er selbst am Glauben seiner Kirche hielt und wie entschieden er auch seine Ueberzeugung aussprach, so hat er sich zugleich gegen nichts mit mehr Bestimmtheit erklärt als gegen die todte Rechtgläubigkeit. Und sein Leben stand mit seinen Worten im schönsten Einklang. Wie nie ein Pastor das Evangelium treuer geliebt und gepredigt hat, so hat auch keiner je gewissenhafter geübt, was er predigte. Seine Predigt war gerade deshalb so gewaltig, weil sie aus einem für das Heil seiner Brüder zitternden, betenden und arbeitenden Herzen hervorging. Schon seine äußere Erscheinung zeigte eine Schwermuth, wie sie jenen edlen und großen Herzen so eigenthümlich ist, welche, wenn sie auch selber in Treue und Ernst der Heiligkeit nachstreben und den Gottesfrieden in ihrer Brust tragen, doch im Hinblick auf Christum und im Bewußtsein der eignen Unvollkommenheit von einer heiligen Trauer erfüllt sind. Man sah an dem blassen, schwermüthigen Antlitze, daß, wenn Adolf Monod seine Zuhörer bei dem Gedanken an die Gerichte Gottes zittern machte, er selbst für sie zuerst gezittert hatte, und das milde Feuer, das aus seinen Augen strahlte, wenn er in seiner unnachahmlich schönen und einfachen Sprache von der Barmherzigkeit Gottes erzählte, offenbarte die Freude und die selige Gewißheit seines eignen Herzens, daß der Vater um Seines Sohnes willen dem aufrichtig bereuenden Sünder Gnade widerfahren lasse. „Als Vertheidiger der in Christo geoffenbarten Wahrheit,“ sagt sein Freund, Pastor Grand Pierre, „hatte er das Herz eines Löwen, er war unerschütterlich in seinen Grundsätzen, und doch zeigte er jedem Menschen, auch seinem Gegner, im Leben das Herz eines Lammes, die Einfalt eines kleinen Kindes; er vereinigte in seinem christlichen Charakter die so selten verbundenen Eigenschaften – männliche Energie und evangelische Sanftmuth.“ Kurz, A. Monod ist der große Redner nicht blos und nicht hauptsächlich durch seine großen Naturgaben, sondern weil er der wahrhaft große, d. h. der durch Christum geläuterte und wiedergeborne, für das Heil seiner Brüder erglühte Mensch war.
Niemand aber hat sich schöner über das, was der Grundgedanke seiner Predigt war und wie er das evangelische Predigtamt auffaßte, besser ausgesprochen, als er es selber gethan in jenen zwei Reden, mit denen er in Paris als Suffragant und als wirklicher Prediger auftrat. Lassen wir darum ihn selber sprechen.
In der am 31. Oktober 1847 bei seiner Einführung als Suffragant des Pastors Juillerat gehaltenen Rede (la parole vivante) sagt er: „Ich möchte nach dem Maße, das mir geworden, beständig die Betrachtung meiner Zuhörer auf die lebendige Persönlichkeit Jesu Christi richten; ich möchte weniger vom Christenthum, von seiner Lehre, seiner Moral und seiner Geschichte reden, als euch den Heiland selbst zeigen und geben. Ich möchte gern noch mehr. Ich möchte mich nicht damit begnügen, der Person Christi den ersten Platz zu geben; ich möchte aus ihr den Mittelpunkt und das Herz meines ganzen Predigtamtes machen; ich möchte sie in jedem andern Gegenstande sehen und jeden andern Gegenstand in ihr. Die Lehre mit Strenge und im Zusammenhang auseinandersetzen und mit Kraft vertheidigen, ist ohne Zweifel nützlich und oft nothwendig; aber ich möchte sie vor allen Dingen aus der Person Christi nehmen: das Erbarmen Gottes aus der Sendung Seines lieben Sohnes; das Geheimniß der Dreieinigkeit aus dem Wunder Seiner Geburt; das dem Glauben umsonst dargebotene Heil aus Seinen Heilungen; aus Seinem Tode den Fluch und zugleich die Sühnung der Sünde; aus Seiner Auferstehung das Unterpfand unserer Auferstehung; aus Seiner Himmelfahrt den Himmel, der sich aufthut, um die Seinigen aufzunehmen, diesen Himmel, dessen Herrlichkeit und Freude Er selber ist. – Es ist ferner gut, die Vorschriften der Moral zu erläutern, sie auf die ersten Prinzipien zurückzuführen, durch die Heilige Schrift zu rechtfertigen und dem Gewissen einzuschärfen; aber ich möchte dies Sittengesetz, damit es ein lebendiges Gesetz wird, vor allen Dingen gern in der Person Christi erforschen: die Liebe in Seiner Sendung, die Selbstverleugnung in Seinem Gehorsam, die Frömmigkeit in Seinen Gebeten, die Wahrheit in Seinen Reden, die Geduld in Seinen Leiden, die Heiligkeit in Seinem ganzen Sein und Wesen. Die biblische Geschichte ferner ist so wahr, so schön und belehrend wie keine andere; aber ich möchte vor allen Dingen gern die zerstreuten Glieder in der lebendigen Einheit der Person Christi verknüpfen, denn Er allein erfüllt alle Jahrbücher der Geschichte vor, während und nach Seiner kurzen Erscheinung auf Erden. – Es ist endlich gut, das Ansehn der Heiligen Schrift auf die Prophezeiungen, Wunder und Thaten zu stützen, weil sie jedem unbefangenen Gemüth die Autorität der Schrift beweisen; aber vor allen Dingen gern möchte ich auch hier geradeswegs auf die Person Christi verweisen, wie Er sich durch das geschriebene Wort kräftigt und diesem das Zeugniß gibt, welches Er von ihm empfängt, wie Er die Inspiration der Propheten anerkennt, die der Apostel verbürgt und so in der Praxis die schwierigsten Fragen der biblischen Kritik löst. Ja, mein göttlicher Heiland, nur in Dir möchte ich den Anfang, das Mittel und Ende meines Predigtamtes suchen! Du bist es, Dein Leben, Deine Person, Dein Geist, Dein Fleisch und Blut, nach welchem mich hungert und dürstet für mich und für die, welche mich hören! Du bist es, den ich auf diese Kanzel tragen, diesem Volke verkündigen, meinen Katechumenen lehren und in den Sakramenten austheilen will! Du, ganz Du, Du für immer!
Ganz abgesehen von den Gründen, die mich zu jeder Zeit bestimmen würden, die lebendige Persönlichkeit Christi vor allen Dingen hervorzuheben, finde ich noch einen besondern Grund in dem religiösen Erwachen, durch welches sich unsre Zeit auszeichnet. Gott hat sich unser erbarmt und unsrer Väter sich erinnert. Er hat allen protestantischen Kirchen das Evangelium Seiner Gnade, das auch sie in der allgemeinen religiösen Erschlaffung vergessen hatten, zurückgegeben. Er hat im Schoße der Reformation eine neue Reformation geschaffen. Dies Erwachen – brauche ich das noch zu sagen? – hat unsre ganze Sympathie. Denn es ist ein Erwachen, dem die Hand Gottes die Hoffnung der Kirche, die Keime einer bessern Zukunft anvertraut hat. Sein letztes Wort freilich hat dies Erwachen noch nicht gesprochen, namentlich ist die Betrachtung der lebendigen Persönlichkeit Jesu Christi noch zu sehr vernachlässigt worden. Wir haben noch immer zu sehr das geschriebene und nicht das lebendige Wort vor Augen gehabt; die ganze Bewegung ist bis jetzt mehr biblisch als geistlich gewesen. Die Rechte der Bibel hat mau in ihrer ganzen – soll ich sagen – Wahrheit oder Strenge anerkannt; man lehrt und predigt die Grundlehren des Evangeliums, besonders die freie Gnade Gottes im Heilswerke, klar und kräftig. Um die Erde dem Evangelio zu gewinnen, namentlich durch die Bibel zu evangelisiren, hat man mit einem Eifer, welcher dem sechzehnten Jahrhundert unbekannt war, über Land und Meer hin die Heilige Schrift verbreitet, so daß ein christlicher Denker sagen konnte, wie das erste christliche Jahrhundert das der Erlösung, das sechzehnte das der Reformation, so sei das neunzehnte das der Bibel. Das ist der Ruhm des jetzigen Erwachens.
Aber reich beladen mit den Früchten des geschriebenen Wortes, hat unsre Zeit in geringerem Grade die des lebendigen Wortes eingesammelt. Die Predigt verkündigt nicht selten mehr die christliche Lehre als Christum selbst; der Heilige Geist hat noch zu wenig das erstorbene Leben der wahren Christen erweckt; die Frömmigkeit hat noch zu viel Dogmatisches, zu viel Aeußerliches in ihren Zwecken, zu viel Lärmen in ihren Werken, zu viel Menschliches in ihren Mitteln. Indem man das Evangelium selbst bis ans Ende der Welt zu verbreiten sucht, müßte man zu gleicher Zeit die täglichen Obliegenheiten des häuslichen Lebens gewissenhafter erfüllen. Man hat zu sehr darauf gesehen. daß die Menschen die Lehre Christi annehmen, aber nicht genug darauf, ob sie Christum auch in ihrem Herzen aufgenommen haben und Ihn überall mit sich tragen. Wird der lebendige Christus nicht fleißiger bei uns einkehren, so wird man uns, so rechtgläubig wir auch sind, sagen können, was man dem kalten und verneinenden Christenthum vorgeworfen hat: „Man hat meinen Herrn weggenommen, und ich weiß nicht, wohin sie Ihn gelegt haben!“
Sodann fehlt unserm Erwachen zu sehr der Trieb nach brüderlicher Einigung, überall tritt die Neigung hervor, sich wegen Dinge, die Gott nicht zur Hauptsache gemacht hat, zu trennen. Möchte doch Christus unter die erbitterten Streiter treten und ihnen zurufen: „Friede sei mit euch!“ Möchten doch Alle ihren Blick auf Ihn gerichtet haben und nur auf Ihn, auf die lebendige Persönlichkeit Christi! Man beklagt sich endlich, daß diesem Erwachen die Kraft der Evangelisation gebricht. Wahr ist allerdings, vielleicht ist die Evangelisation seit den apostolischen Zeiten nie so allgemein, so rein, so thätig und hingebend gewesen; aber der Erfolg steht in keinem Verhältniß zu den Anstrengungen und Opfern. Man sieht jetzt nichts Aehnliches wie in den Tagen der Reformation, wo die große Bewegung ganze Nationen mit sich fortriß. Sollte dieß daher kommen, daß die Welt jetzt so wenig Empfänglichkeit für das Evangelium besitzt? Oder sollte der Grund nicht vielmehr darin zu suchen sein, daß wir der Welt uns zu sehr mit dem geschriebenen Worte und mit der Idee, aber nicht genug mit dem lebendigen Worte und mit dem Leben genaht haben? Lehrbeweise liebt die Zeit nicht, gebt ihr in der Person des Heilandes etwas Direkteres, Ergreifenderes, Lebendigeres. Ihr habt eure Zuhörer nicht von der Bibel zu Jesus führen können; versucht es, sie von Jesus zur Bibel zu führen. Gebt ihnen die Bibel durch die Hand Jesu, als das Buch Jesu, und sie werden, wenn sie anders ein grades, offenes Herz haben, erkennen, daß Jesus des Menschen Ruhe, des Menschen Heil, der Gott des Menschen ist.“
Dieselben Gedanken, welche die deutsche evangelische Welt sich gleichfalls sagen und zu Herzen nehmen muß, führt Monod in der zweiten Rede, die er am 5. August 1849 am Tage seiner Einführung als Pastor der reformirten Kirche zu Paris hielt, (la vocation de l’Église) noch weiter aus. Auch ihr entnehmen wir einige, sowohl A, Monod charakterisirende, als auch in unsern Tagen sehr beherzigenswerthe Gedanken über den Beruf der Kirche.
„Wie Christus der Fleisch gewordene Gott ist, so soll die Kirche der Fleisch gewordene Christus sein. Sie muß Gott lieben, wie Jesus Christus den Vater liebte; sie muß die Brüder also lieben, daß die Welt unwillkürlich ausrufen muß: „Sehet, wie haben sie einander so lieb!“ Sie muß endlich ein solches geistiges und geistliches Leben entwickeln, daß der Herr ihr wie der Kirche der ersten Zeit Tag für Tag tausend wahrhaft Bekehrte zuführt. Dies Glück kann ihr aber nur werden, wenn sie Jesu Leben, dies reiche Leben des Gehorsams, der Liebe und der Aufopferung, wieder lebt. Das würde ihr die Herzen auch ohne Worte gewinnen; zu dieser Insel der Heiligkeit, der Liebe und des Friedens würden aus dem Ocean der Sünde, der Selbstsucht und der Unruhe die Menschen eilen wie zu einem zweiten Eden; vor diesem Beweise des Geistes und der Kraft wären keine Zweifel und Einwürfe möglich. Mit solchen Bundesgenossen wäre die Kirche allmächtig; eine solche Kirche gibt der Predigt der Apostel mehr, als sie von ihr empfängt, – Seien wir Erben der ersten Kirche, und zwar nicht blos ihrer Lehre, sondern auch ihrer Werke, nicht blos Nachahmer ihres Glaubens, sondern auch ihrer Liebe. Klagen wir nur nicht ohne weiteres unsre Zeit der Lieblosigkeit und des Unglaubens an; schlagen wir an unsre eigne Brust. Unsre Zeit ist wahrlich nicht unempfänglich, sie muß nur von den Gläubigen Thaten sehen, den Geist Christi in dem Leben der Frommen spüren. Es gibt viele aufrichtige, nach der Gerechtigkeit hungernde und durstende Seelen; aber sie sind zaghaft, ihnen fehlt die Thatkraft, die Entschlossenheit voranzugehen; sie erwarten nur ein Zeichen, um sich zu erheben und ohne Rückhalt ihrem göttlichen Meister zu ergeben. Hören sie nur von einer noch so kleinen Gesellschaft reden, die es sich angelegen sein läßt, aus diesem göttlichen Leben eine geistige Realität, aus diesem brüderlichen Leben eine kirchliche Realität, aus diesem Missionarleben eine sociale Realität zu machen, so sollt ihr sehen, sie fliegen euch zu, wie die Eisentheilchen dem Magnet, der sie anzieht. Die Herzen sind bereit, es braucht nur ein Weg gebahnt, ja nur ein Zeichen gegeben zu werden. Darum die Hand ans Werk! Nur Eins thut noth – ein Herz voll Glaube und Hingebung, ein Glaube ohne Wanken und Schwanken, eine Hingebung ohne Rückhalt und ohne jegliche Selbstsucht. Wesley forderte nur zehn wahre Methodisten, um England zu erneuern; von zehn wahren Protestanten hoffte ich eben so viel für die reformirte Kirche Frankreichs. Möchten sich doch alle evangelischen Christen zu dem gemeinsamen Werte einer innern Neubelebung der Kirche die Hand reichen! In allen Kirchen und Confessionen findet sich ein Volk Gottes, klein an Zahl, aber groß an Glauben und Liebe, jenes Volk Gottes, das die Kirche der Zukunft, die geistige, brüderliche, missionäre Kirche, herbeizuführen trachtet. Möchte diese neue Ordnung der Dinge kommen! Nach ihr seufzt die ganze Christenheit.“
Ueber die Veränderung, welche durch seine Ernennung zum Pastor in seiner Stellung eintrat, spricht sich Monod in dieser Rede also aus: „Die einzige Veränderung, welche dieser Tag (5. August 1849) in meiner Stellung hervorbringt, ist die, daß ich aus einem Prediger (prédicateur) ein Pastor werde, und damit vom Worte mehr zum Thun, oder vielmehr, da ich die Theorie nie von der Praxis getrennt habe, von der action individuelle zur action collective übergehe. Als Prediger mußte ich die Gläubigen zu bilden, als Pastor muß ich die Kirche zu entwickeln, zu verbessern, und, wenn sich die Gelegenheit bietet, zu reformiren suchen. Diese Aussicht erschreckt und erfreut mich zu gleicher Zeit. Sie erschreckt mich wegen der Ausdehnung, die mein Amt von jetzt an erhält, denn es steigt von der christlichen Kanzel herab, um sich auf der Straße, im Hause, im Leben zu bethätigen; aber sie erfreut mich zugleich, weil mich nach der öffentlichen und lebendigen Anwendung der Lehre, die ich verkündige, verlangt. Uebrigens kann die Predigt dadurch nur gewinnen. Ich fühle täglich mehr, daß, wie Vinet sagt, eine Rede in Wahrheit nur dann etwas nützt, wenn sie zugleich eine That (action) ist. Ihr Alle fühlt es mit mir: Schöne Reden sind, Gott sei Dank, auf der christlichen Kanzel wie auf der politischen Tribüne nicht mehr Mode; man verlangt von uns eine einfache Ermahnung, die, schön durch ihre Wahrheit und reich an Heiligkeit, gradeswegs zum Ziele hinstrebt und das Evangelium von der Höhe der rednerischen Kunst zu der Wirklichkeit des Lebens hinabsteigen läßt.
Das evangelische Predigtamt ist nach dem Evangelio ein Dienst, nicht eine Autorität; wenn der Hirt seiner Heerde vorangeht, so geschieht es nicht, um sie zu regieren, sondern um im Namen und im Interesse aller Glieder der Kirche die Gnaden, welche Gott der ganzen Kirche gespendet hat, zu verwalten. Groß durch seine Demuth, wie das Werk des Hirten der Hirten, der nicht gekommen ist, sich dienen zu lassen, sondern selber zu dienen, wird das evangelische Hirtenamt seine Aufgabe um so vollkommener erfüllen, als es geneigt ist, vor der Kirche zu verschwinden und von sich sagt, was Johannes der Täufer von seinem Meister und Herrn sagt: „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen.“ Ich will mich bestreben, ganz meiner pastoralen Wirksamkeit zu leben; so viel ich kann, will ich von Haus zu Haus das Wort Gottes bringen und es auf alle Bedürfnisse eurer Seele und eures Gebens anwenden; ich will für euch beten und durch inbrünstiges Flehen dahin trachten, daß der Same des göttlichen Wortes, den ich mit meinen schwachen Händen ausstreuen werde, in euren Herzen aufgehe. Und das Alles will ich thun ohne Schmeichelei und Menschenfurcht und ohne Parteilichkeit, ohne daß ich die Reichen den Armen, oder die Armen den Reichen vorziehe. Doch, ich wage nicht zu sagen, daß ich es thun werde, ich habe zu sehr gelernt, mir selber zu mißtrauen; aber ich habe wenigstens den Willen, es zu thun, und bitte Gott, Er möge in Seiner Gnade meine Kraft stärken. Er weiß, daß ich meine Aufgabe mit Ernst erwogen habe, daß ich mit Ernst an ihre Lösung gehe, und ich hoffe, ihr wißt es auch; ich glaube in eurem Gewissen das Zeugniß zu lesen, welches es mir gibt, und sollte Jemand unter euch anstehen, es mir zu geben, so will ich es ihm durch mein Leben abzuringen suchen. Von der Wahrheit, wie ich sie gefaßt habe, von der Lehre der Gnade Gottes, auf der das Evangelium und unsre Kirche ruht, von dieser weitherzigen und geistigen Auffassung der Wahrheit, in der ich durch das Forschen im Worte, durch die Unterweisung des Geistes und durch die demüthigende Erfahrung meines Lebens etwas gelernt zu haben glaube, werde ich fürder nimmer weichen. Zugleich sollt ihr, deß bin ich gewiß, erkennen, daß ich die Wahrheit in Liebe üben werde und daß ich nach der Treue in meinem Amte nichts lieber habe als Eintracht und Frieden. Nehmt mich mit dem Vertrauen auf, mit dem ich euch entgegenkomme.“
„Ich komme zu euch “, spricht er an einer andern Stelle, „mit der Liebe Gottes im Herzen. Ich will die Gewissen nicht einschläfern, sondern zu ihrem Heil aufwecken. Ich will die Sterbenden nicht selig sprechen, sondern die Lebenden retten. Wie glücklich wäre ich, o wie glücklich, könnte ich euch alle wie einen einzigen Menschen in meine Arme und an mein Herz schließen, um euch in die sichersten Arme und an das treueste Herz zu legen.“ Und für sich selber betete er: Stütze mich, o Herr, durch Deine Gnade; und während die wahren Christen das Vorbild der Heerde sind, so mache mich, den Hirten, zum Vorbild der Christen! Mache mich wie den Timotheus zum Vorbild der Gläubigen in Worten und im Wandel, in der Liebe, im Geist, im Glauben, in allen Dingen. Lehre mich über mich selbst wachen und über die ganze Heerde, über die der Heilige Geist mich zum Hirten bestellt hat, damit ich Deine Gemeinde weide, die Du mit Deinem Blute Dir erworben hast. Lehre mich meine Arbeiten verrichten wie ein guter Streiter Christi; lehre mich gern leiden, wenn nur Dein Wort nicht gebunden ist; laß mich mein Leben nicht für kostbar achten, wenn ich nur in Freuden vollende meinen Lauf und das Amt, welches ich von unserm Herrn Jesus empfangen habe, die frohe Botschaft Seiner Gnade zu verkündigen, auf daß ich, nachdem ich das Evangelium durch meine Rede gepredigt und durch mein Leben bewiesen habe, wenn Du mich aus dieser Welt abrufst, vor meinem Sterbebette alle Häupter dieser Gemeinde versammeln und ihnen an der Gränze der Ewigkeit mit Paulus in Wahrheit sagen kann; „Ihr seid mir deß Zeugen, daß ich die Pflicht eines treuen Hirten erfüllt habe; ich bin rein von eurem Blute und dem Blute der Eurigen.“
Die Aufgabe aber, die sich Monod mit solcher Klarheit und Entschiedenheit stellte, nämlich durch seine Predigt und durch sein Leben seinem Heilande Seelen zu gewinnen, hat er bis zu seinem Tode mit dem ganzen Ernste und der vollen Treue eines Jüngers Jesu Christi erfüllt. Monod wurde aber auch in seinem Vertrauen und in seinen Erwartungen nicht getäuscht. Mochte Monod im Oratoire oder im Penthémont predigen, die Kirche war schon lange vor dem Beginne des Gottesdienstes gefüllt; Katholiken wie Protestanten eilten herbei, und Viele fanden keinen Platz mehr in den überfüllten Räumen. Und wie Vielen gab Monod in seinem Hause Lehre, Trost und Unterstützung. Dies Haus in der stillen Straße Lateur d‘ Auvergne war von französischen Protestanten wie von Reisenden aus allen Ländern, besonders von Engländern, vom Morgen bis zum Abend aufgesucht. Die Einen kamen, um den musterhaften Seelsorger, die Andern, um den berühmten Redner zu sehen, und Alle schieden mit dem Gefühl, einen edlen Mann und wahren Christen kennen gelernt zu haben.
Manche haben sich über den Eindruck, den Monod auf sie als Kanzelredner machte, ausgesprochen; wir wollen nur Dr. Ebrard hören, der den Redner in der reformirten Kirchenzeitung vom Jahre 1852 besonders treffend charakterisirt hat. Nicht etwa pikante Gedanken, frappante Wendungen, nicht Glanz der Rhetorik, Pracht der Sprache, hinreißender Strom der Bilder, ebensowenig ein künstlicher, oder was man so nennt, brillanter Vortrag war es, der sich in Monod’s Reden zur Schau stellte. Der Vortrag war wie der Stil und der Stil wie der Mann: schlicht, demüthig, einfach und natürlich, aber kraftvoll, Mark und Bein durchdringend, nicht trotz jener Schlichtheit und Wahrheit, sondern durch dieselbe.
„Monod ist schon durch natürliche Begabung einer der geistvollsten Menschen. Nicht überraschende gute Einfälle sind es, mit denen er wie mit Perlen das Gewand seiner Rede stickt, – wenn das geistreich heißt, so sind Viele geistreich; sondern bei ihm wirken alle Geistesthätigkeitem Gedächtniß, Gelehrsamkeit, Combinationsvermögen, Tiefsinn, Scharfsinn in glücklicher Harmonie zusammen. Der Zuhörer oder Leser geräth allerdings aus einer Ueberraschung in die andere durch die sprudelnde Fülle neuer, treffender Gedanken, Gesichtspunkte, Blicke; aber es sind nicht etwa blendende Gedanken, die hinterher bei näherer Besichtigung wie Seifenblasen zerrinnen, sondern es sind gehaltvolle, tiefbegründete Gedanken, deren je einer Stoff genug bietet, um Stunden lang darüber nachzudenken, deren je einer oft über ganze Partien der Heiligen Schrift ein nie geahntes Verständniß eröffnet. Denn – und das ist die Hauptsache – diese Gedankenfülle ist nicht etwa mühsam zusammengeholt, sondern man fühlt und sieht, wie die Gedanken dem Manne zuströmen, wie so ganz natürlich einer aus dem andern fließt und hervorwächst; aber das kommt freilich daher, daß Monods Predigten auf dem treusten, gründlichsten wissenschaftlichen, exegetischen und dogmatischen Studium ruhen.
„Zu dieser Geistesfülle gesellt sich bei A. Monod eine seltene Schönheit und Reinheit des Stils. Die französische Sprache hat an sich etwas Kaltes, in seinem Munde wird sie zur Sprache der Herzlichkeit; sie hat etwas Rhetorisches, zu Bombast Verlockendes, in seinem Munde wird sie schlicht, und bei all dieser Schlichtheit ist seine Rede doch wie von Blitzen durchzuckt, welche zünden und einschlagen. Gewandt und treffend, anmuthig und einschlagend, zwanglos und markig, schlicht und hinreißend ist seine Diktion; es ist hier vereint, was sich sonst nur selten vereint findet. Und ebenso sein Vortrag. Man denke sich einen nicht sehr großen Mann, Herzensgüte und christliche Liebe mit Feuer und Energie in seinen Mienen gepaart, von Natur mit einer nicht gerade starken, aber merkwürdig reinen, klangreichen Stimme begabt; er besteigt sehr anspruchslos die Kanzel und beginnt nun ganz zwanglos zu reden, nicht wie Einer, der eine Predigt halten will, sondern wie Einer, der gar viele heilsbedürftige und heilsdurstige Sünder und Mitgenossen der Gnade vor sich sieht und nun mit ihnen sich über das, was ihm das heiligste und Theuerste ist, unterhalten will. Mit dem Inhalte wird seine Rede lebhafter und ernster, von willkürlichen, gemachten oder gar theatralischen Modulationen der Stimme keine Spur, ebensowenig von nicht überwundenen üblen Gewohnheiten und unschönen Manieren.“
Das lebendige Wort, wie es von den Lippen dieses von seinem Gegenstande ganz durchdrungenen Mannes strömte, hob natürlich den Eindruck der Reden Adolf Monod’s; aber daß die äußere Beredsamkeit nicht den Mangel der innern Gediegenheit verdeckte, sondern daß der innere Werth den großen, bleibenden Eindruck dieser Reden hervorbrachte, dafür zeugt unwiderleglich die Wirkung der Worte Monod’s auf den Leser seiner Reden. Und nicht minder bezeichnend ist ferner, daß die Reden Monod’s uns nicht nur zu einmaligem Lesen einladen, sondern daß wir gern zu ihnen zurückkehren, ja die meisten uns bei wiederholtem Lesen mehr und mehr ansprechen. Namentlich ist die Fülle tiefer und feiner Züge aus dem Seelenleben des Menschen in jeder Rede so groß, der Reichthum feiner, geistvoller und praktischer Bemerkungen so unerschöpflich, daß auch der aufmerksamste Leser nicht im Stande ist, jeden dieser vielen einzelnen das Leben charakterisirenden Züge beim ersten Lesen in seiner ganzen Bedeutsamkeit zu würdigen.
Ja, in dieser Beziehung verdienen sie ganz besonders von unsern Predigern studirt zu werden. Es ist eine alte Klage, daß unsere deutsche Kanzelberedsamkeit im Allgemeinen an einer gewissen Einförmigkeit der Ideen leidet und der Kreis der behandelten Gegenstände ein gar zu beschränkter ist. Unsere Prediger bleiben oft zu sehr im Allgemeinen und Abstrakten, sie tadeln Zweifel und Unglauben, verfolgen aber die Seelenzustände des Zweiflers und des Gläubigen zu wenig in ihrem Entstehen und in ihrer Vollendung; sie schildern mehr die traurigen Folgen des Nihilismus und des Materialismus im häuslichen wie im öffentlichen Leben, als daß sie durch die Darstellung des innern Glückes, des innern Befriedigtseins und der reichen gesegneten Wirksamkeit eines Jüngers Jesu Christi die schwankenden und unbefriedigten Seelen zu gewinnen trachteten. Das Evangelium erhielt dann gar leicht etwas Herbes, Kaltes und Erkältendes, die Dogmatik etwas Nüchternes und Todtes, während sie in Monods Munde stets etwas Gewinnendes, Lebendiges, Praktisches, aus dem Herzen Kommendes und zum Herzen Dringendes hat. Die Dogmen sind bei ihm nicht etwas durch den Buchstaben der Schrift oder der Glaubensbekenntnisse Gebotenes, sondern Wahrheiten, die Jeder, der sich redlich selbst prüft und es ehrlich mit seinem Seelenheile meint, in ihrer rettenden und beseligenden Kraft anerkennen muß, Predigten wie Nathanael, die großen Seelen, das Glück des christlichen Lebens und andere bekämpfen den Irrthum besonders dadurch so kräftig, daß sie dem Elende und der Ohnmacht des Ungläubigen gegenüber die Glückseligkeit und die weltüberwindende Kraft des in Christo Wiedergeborenen in überwältigender und zugleich gewinnender Weise darstellen. Sie beweisen durch die Analyse der Seelenzustände auf einfache und überzeugende Weise die Tiefe, die Gewißheit und die Kraft der christlichen Heilswahrheiten. Wie der Beweis des Geistes und der Kraft geführt werden muß, zeigt Monod dem christlichen Kanzelredner wie kaum ein Anderer unter den Rednern der neueren Zeit. –
Kehren wir noch einmal zu Monods Leben und zwar zu seinen letzten Lebenstagen zurück; denn wer könnte von diesem Manne sprechen, ohne seines Todes zu gedenken! Die Geschichte der christlichen Kirche führt uns an wenige so ergreifende Krankenlager. Monod hat nie so erschütternd die weltüberwindende Macht des Evangeliums gepredigt wie in jenen Monaten, als ein unsäglich schmerzhaftes Leiden ihm nur noch erlaubte, seine Predigt durch seinen Duldermuth und seine Gottergebenheit zu bestätigen.
Lassen wir auch hier einen Augenzeugen sprechen. Krummacher, der 1855 der Versammlung des evangelischen Bundes zu Paris beiwohnte, berichtet uns in seiner Sabbathglocke über diese schreckliche und doch wieder so erhebende Leidenszeit Adolf Monods. „Einen der bewährtesten und begabtesten protestantischen Christen Frankreichs, den ersten kirchlichen Redner seiner Nation, trafen wir auf dem Krankenbette an, von welchem er, ärztlicher Aussage nach, seine Himmelfahrt halten dürfte. Dieser Umstand breitete einen Trauerflor über unsere Versammlungen aus; doch träufelte er auch nährendes Oel in die Beterglut der brüderlichen Liebe. Die Stunden, die ich mit dem Missionar Ostindiens, dem trefflichen Dr. Duff, an dem Schmerzenslager jenes theuren Bruders zugebracht, nenne ich die erhebendsten, die seligsten und gesegnetsten meines ganzen Aufenthalts in der Weltstadt. Sein Angesicht leuchtete wirklich wie eines Engels Angesicht. Als wir uns in Klagen zu ergießen begannen, daß er uns hier und nicht mehr auf dem Felde seiner so reich gesegneten Wirksamkeit begegne, lächelte er und schien uns durch seine Mienen zu fragen, ob wir das Wort nicht kennten: „Es sind auch eure Haare auf eurem Haupte alle gezählt.“ Er wußte, daß die Aerzte nicht eben viele Hoffnung mehr auf seine Wiedergenesung setzten; aber er glaubte an den Tod nicht mehr, weil der Herr bezeuge: „Wer da lebt und glaubet an mich, der wird nimmermehr sterben.“ Wie war seine Stirn so wolkenfrei und klar, und wie floß sein Mund nur von Ergüssen des Glaubens, der Ergebung und der Liebe! Wir knieeten bei seinem Lager und beteten mit einander, selig in lebendigster Erfahrung des erfüllten Verheißungswortes: „Wo Zwei oder Drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen.“ Er betete dann, unbehindert durch die brennenden Schmerzen, die ihn nicht einen Augenblick verließen, mit kräftig gehobener Stimme selbst, und – welche demüthige, goldgrundig lautere und geheiligte Seele sahen wir in der Weihrauchwolke des Gebets sich himmelwärts schwingen! – Sollte es dem Herrn gefallen, den geliebten Bruder heim zu rufen, so sage ich und werde immer sagen: „Mein Ende sei wie dieses Gerechten Ende!“ Sagt Alle getrost mit mir dasselbe: denn man kann nicht friedsamer und seliger an des Todes Thüren liegen, als wir ihn da gebettet sahen. In der Versammlung verbreitete sich die Kunde, wen es dränge, den kranken Bruder auf seinem Siechbette mit einem Gruße der Liebe zu erfreuen, der finde dazu ein Blättchen in der Sakristei in den Händen der Vorstandsglieder des evangelischen Bundes. Bald waren die Blätter alle vergriffen, und theils schon an demselben Abend, theils am folgenden Morgen kamen sie zurück, mit feurigen Liebeszügen bedeckt, auch wohl getränkt mit Thränen. Gebetlein standen darauf, herzliche Danksagungen, Worte des Trostes, Liebessprüche, Verslein rc., und ich denke, sie werden dem kranken Bruder einige Erquickungen gebracht haben. Mir kamen diese Blatter vor wie frische Frühlingsblätter, am schönen Baume der Gemeinschaft der Heiligen getrieben, und in dieser Gemeinschaft zugleich als liebliche Zeugen, daß von der apostolischen Kirche doch noch etwas auf Erden gesunden werde.“
Diese entsetzliche Krankheit währte zwei Jahre. Die ersten sechs Monate widmete er einer gezwungenen Unthätigkeit und einer peinlichen Ruhe; die folgenden sechs Monate gehörten wieder trotz der unaufhaltsam fortschreitenden Krankheit seinem Amte; fast ein ganzes Jahr war er dann noch bei immer steigenden Schmerzen an sein Krankenlager gefesselt. Ende September 1855 erkannte Monod die Gefahr, in welcher er schwebte, er bestellte sein Haus und schloß sich nun um so inniger an Gott und seinen Erlöser an. Auch in den letzten neun Monaten, wo er sein Bett nicht mehr verlassen konnte und den Tod langsam, aber sicher herankommen sah, zeigte er unter brennenden Schmerzen stets dieselbe ruhige und heitere Unterwerfung unter Gottes Willen, unter den Willen eines erbarmungsvollen und weisen Vaters. Was der Glaube an den Erlöser, die Liebe zu Gott, die Kraft des Glaubens und die Hoffnung des ewigen, seligen Lebens vermögen, hat Adolf Monod wie kaum ein anderer Märtyrer der Kirche gezeigt. In dem Grade, wie der äußere Mensch zerstört wurde, wuchs der innere Mensch, wurde er stark in Jesu Christo. Er war nie beredter als auf dem Lager der Schmerzen, nie stärker als auf dem Lager der Schwäche; er, der für seine eignen Prüfungen alles Muthes bedurfte, ermuthigte Andere; in dem halb erstorbenen Leibe lebten und arbeiteten die Kräfte des Geistes und der Seele ungeschwächt weiter; als seine Hand keinen Buchstaben mehr zu schreiben vermochte, hatten seine Worte nichts von ihrer Kraft und Klarheit verloren. Als seine Familie am 6. Oktober 1855 sein Sterbebett umgab, sprach er; „Wenn ich den Himmel offen sähe und Gott mir sagte; Komm, ich erwarte dich – ich könnte nicht ruhiger über meine Zukunft und meine Seligkeit sein, als ich es jetzt bin.“ In dieser Zeit äußerte ein Amtsbruder, wie das heilige Abendmahl ein stärkendes Gnadenmittel sei, es würde ihm auf seinem Schmerzenslager zur höchsten Erquickung gereichen. Der Kranke folgte dem Rath und ließ sich nun jeden Sonntag das heilige Mahl reichen, an dem bald auch einige Freunde Theil nahmen. Vom 14. Oktober 1855 an richtete er an die Versammelten einige Worte und setzte dies ohne Unterbrechung bis zum 30. März 1856 fort. Prediger der verschiedenen evangelischen Kirchengemeinschaften, Reformirte, Lutheraner, Independenten, Wesleyaner, administrirten bei diesem Feste der brüderlichen Liebe am Krankenbette ihres sterbenden Bruders. Dreißig bis vierzig Personen feierten so das heilige Mahl in seinem Zimmer mit Gebet, Gesang, Bibellesen und Austheilung des Sakraments; dann ergriff Monod, nicht als Prediger und Redner, sondern als ein sterbender Bruder ohne lange Vorbereitung das Wort und sprach oft mit der Lebendigkeit und Kraft wie ehemals in gesunden Tagen, immer aber mit einer Wirkung, wie sie der beredte Mann schwerlich jemals auf seiner Kanzel geübt hatte. In den letzten Wochen erlaubten es die abnehmenden Kräfte dem Leidenden nicht, die Abendmahlsgenossen eine Stunde lang in seinem Zimmer zu empfangen; der administrirende Pastor brachte dem Kranken dann die geistliche Nahrung an sein Bett und darauf traten alle vor das Krankenlager, um Monods Worte des Trostes, der Belehrung und der Ermahnung zu vernehmen. Oft sprach er unter heftigen Schmerzen und litt jedesmal in der Nacht vom Sonntag auf den Montag um so heftiger. Er wußte dies, aber er ergab sich gern darein. „Ich leide sehr,“ sagte er eines Sonntag Abends, in der Nacht vom Sonntag auf den Montag, „aber es muß so sein; es ist ein Opfer, welches ich meinem Gott gern bringe.“ In einem Gebete sagt er. „Wenn ich auch jede Woche durch ein verdoppeltes Leiden das Vorrecht erkaufen muß, Dein Wort zu verkündigen, Dein Wille geschehe und nicht der meinige.“ Vier Wochen vor seinem Tode sprach er noch den Wunsch aus, Gott möge ihm bis zu seinem Ende die Gnade erweisen, Ihn zu verherrlichen und zu preisen. Diese Gnade wurde ihm zu Theil. Am Osterfeste, 23. März, hielt er seine letzte längere Rede über die Auferstehung Christi, und am 30. März raffte er die letzten Kräfte zusammen, um die ewige, unendliche Liebe Gottes zu preisen, und beschloß so in einem feurigen Dankgebete seine Predigt und sein Predigtamt auf Erden, beschloß es wie sein Meister und Herr mit einem priesterlichen Gebete. In einer Predigt am Weihnachtsfeste 1854 sprach Monod: „Wenn unter dem mannigfachen Kreuz, das euch der Herr zu tragen gibt, eins ist, das euch, ich will nicht sagen, schwerer als die andern zu tragen scheint, sondern euch für euren Dienst störend, ja todbringend für alle Hoffnungen eures heiligen Berufs erscheint, wenn sich die äußere Versuchung zur innern gesellt, wenn Alles, Leib, Geist und Seele, elend, kurz, wenn Alles unrettbar verloren scheint, so nehmt auch dieses Kreuz oder diese Kreuzeslast in einem besonders demüthigen, hoffenden und dankbaren Sinne hin als ein Leiden, in welchem euch der Herr einen ganz neuen Beruf will finden lassen; begrüßt es als die Quelle des Dienstes der Trübsal und der Schwachheit, welchen Gott als den besten und schönsten für das Ende aufgespart hat und den Er reichlicher mit den Früchten des Lebens segnen will, als je vorher euren Dienst der Kraft und Fülle.“ Dies Wort sollte sich an Monod selbst bewähren. Seinem Predigtamte fehlte nichts als das Siegel dieser letzten furchtbaren Krankheit; wer ihn in den Tagen seiner Kraft gehört und nachher in den Tagen der Schwache gesehen hat, der kann sagen, ob der Prediger in der Fülle körperlicher Gesundheit und aller Freiheit seines Geistes wirksamer und segensreicher zu seinem Herzen geredet hat oder der leidende und sterbende Christ. „Unsre menschliche Natur,“ sagt Köstlin so schön und wahr, „hegt freudige Bewunderung für Männer, welche einer augenblicklichen Todesgefahr, wenn ein höherer Beruf es fordert, mit festem Muthe sich entgegenwerfen. Als etwas noch höheres verehren wir es, wenn Einer, wie der edelste griechische Philosoph, in einer ruhigen Erwartung des sicheren, unmittelbar bevorstehenden Todes auch von keiner innern Aufregung in der schönen sittlichen Harmonie seines Innern und in der Offenbarung desselben seinem Nächsten gegenüber gestört wird. Hier aber haben wir ein Beispiel, wo der gleichsam schon zum Tode verurtheilte noch eine Zeit des Wartens, die Leidenden sonst endlos lang zu sein dünkt, zu bestehen hat, und doch, während seine Lage für jeden theilnehmenden Beobachter etwas peinlich Spannendes haben mußte, nie in eine unnatürliche Steigerung seiner Stimmung verfällt.“
Ehe am Sonntag, den 6. April 1856, die Stunde der Versammlung gekommen war, und während in den reformirten Kirchen, wie seit mehreren Monaten, für den sterbenden Bruder und Pastor gebetet wurde, hatte der fromme Dulder Nachmittags bald nach ein Uhr ausgelitten und der Herr seine Bitte erhört: „Que ma vie ne s’éteigne qu’avec mon ministère, et que mon ministère ne s’éteigne qu avec ma vie.“ Die evangelische Kirche Frankreichs zählt viele Märtyrer, die in den Flammen des Scheiterhaufens und unter den Qualen der Tortur ihr Leben ausgehaucht haben; in Adolf Monod erhielt sie einen neuen Märtyrer aus jener Klasse, die auf einem langen Schmerzenslager der Welt lehren, was der Glaube an Christum, die Liebe zu Christo und die Hoffnung auf Christum vermögen. –
Die Worte, welche Monod in jenen Schmerzenstagen von seinem Sterbebette aus gesprochen hat, wurden von seinen Kindern, gleich nachdem sie geredet waren, nach dem Gedächtniß aufgezeichnet und sind unter dem Titel: „Les Adieux d‘ Adolphe Monod“ gedruckt worden: – ein theures, reich gesegnetes Vermächtniß des großen Redners, ich will lieber und richtiger sagen, des großen Christen, des demüthigen Jüngers Jesu Christi!
Am Tage des Begräbnisses, dessen Kosten, wie ehemals bei seinem Vater, der Presbyterialrath der reformirten Kirche zu Paris übernommen hatte, Dienstag den 8. April, 1 Uhr Nachmittags, fand der Gedanke, der ihn sein Lebenlang beseelt hatte, und den er in der Stiftung des evangelischen Bundes und in der von Reformirten, Lutheranern und Independenten an seinem eignen Sterbebett gemeinschaftlich gefeierten Communion so ergreifend verwirklicht sah, der Gedanke der Einigung der verschiedenen äußern Gemeinschaften der evangelischen Kirche einen schönen Ausdruck. Nicht blos daß trotz des strömenden Regens und des heftigen Windes aus allen Kreisen der Gesellschaft die von Adolf Monod auf den Weg des Lebens geführten und geleiteten Gläubigen, selbst viele Frauen, zum Trauerhause eilten, sondern alle Geistlichen der verschiedenen evangelischen Kirchen von Paris fanden sich im Trauerhause und auf den Friedhofe Père-Lachaise ein, wo sich das Familienbegräbniß befindet, und am Grabe selbst sprach nicht blos Juillerat, der Präsident des reformirten Consistoriums, sondern auch Cuvier, der Präsident des Consistoriums der Augsburger Confession, und Edmund v. Pressensé als Vertreter der Independenten. Sie alle sprachen es aus, wie sie nicht blos den Glanz der seltenen Talente Adolf Monods, die Macht seines Wortes, den tiefen Ernst seines Lebens und die Stärke und Innigkeit seines Glaubens bewunderten, sondern sich auch im Grund des Glaubens mit ihrem heimgegangenen Bruder einig fühlten.
„Wir haben nie mehr gefühlt“, sagt Coquerel, der Jüngere, der mit seinem Vater mehr die rationalistische Richtung in der reformirten Kirche vertritt, „wir haben nie mehr gefühlt, daß Gott, Christus und das Evangelium, die uns vereinigen, größer und mächtiger sind als die Dogmen, welche uns trennen. Am Grabe Adolf Monod’s und seines Vaters, in der Mitte seiner Brüder, seines einzigen Sohnes, auf den sich Aller Blicke mit tiefer Theilnahme richteten, in der Mitte dieser zahlreichen, in allen ihren Gliedern so achtungswerthen Familie, die unsrer Kirche schon drei Geschlechter von Pastoren gegeben hat, von denen einer als Opfer der Treue kurz vorher in der Krimm seinen Tod gefunden hatte, fühlten wir uns alle wahrhaft als Brüder im Schmerze und in der Trauer, im Glauben und in der Hoffnung.“ Und Cuvier, der Präsident des Consistoriums der Augsburger Confession, sprach am Grabe: „Wir weinen mit euch, den Brüdern der reformirten Kirche, unser Schmerz ist dem eurigen gleich; auch wir haben Theil an dem gesegneten Einfluß. den er ausübte; das Gute, was er vollbrachte, ist unser gemeinsames Erbe. Wir theilen mit euch die Früchte seiner evangelischen Thätigkeit, des Vorbildes in der Treue und Festigkeit seines Glaubens, und der Inbrunst in Hingabe seines Eifers, im Vertrauen auf Gott inmitten schwerer Leiden, in der Liebe für unsern Erlöser, in dem Frieden, mit welchem er dem Tode entgegensah, und in der Freude und Hoffnung, mit der er seinen Geist in Gottes Hände befahl.“
Die ganze evangelische Kirche Frankreichs fühlte sich tief erschüttert bei der Nachricht, daß Adolf Monod in der Kraft und Reise seiner großen Gaben ihr entrissen sei. Seit Vinet, der schon im Alter von fünfzig Jahren abberufen wurde, hatte die reformirte Kirche Frankreichs in keinem ihrer Pastoren eine solche Vereinigung glänzender Talente, tiefer Demuth und frommen Lebens gesehen, und nun wurde ihr auch Monod so früh im Alter von 54 Jahren entrissen; ja fast zu derselben Zeit starb ihr noch ein zweiter durch Beredsamkeit und evangelischen Lebenswandel hervorragende Geistliche, Verny, schon im 49. Lebensjahre, und zwar im wunderbaren Gegensatze zu Adolf Monod ohne Krankheit, ohne Schmerz und Todesqual, in der Mitte einer feurigen, begeisterten Rede auf der Kanzel der Thomaskirche zu Straßburg am 16. Oktober 1854 vom Schlage getroffen. Wer wird die Lücken ausfüllen, wenn Gott uns die Besten und Stärksten, die, welche uns als Führer vorangingen, entreißt? fragte die evangelische Kirche Frankreichs in ihrer Klage; aber vom Grabe solcher Männer her stärkt der Anhauch ihrer Kraft; das Bewußtsein, solche Todte sind nicht gestorben, sondern sie leben in Gott, leben im Herzen der Gläubigen, leben durch ihr Leben und ihre Werke in der Kirche fort, ermuntert und stärkt die Lebenden, keine unfruchtbaren Thränen zu weinen und nicht zu klagen als Solche, die keine Hoffnung haben. sondern in den Wegen solcher Glaubenszeugen zu wandeln und das Werk derselben bis zu dem Tage der eignen Ruhe und des Widersehens mit gottvertrauendem Muthe fortzusetzen. Alle, die mit nassem Auge an Adolf Monod’s Grabe standen, erfüllte die Zuversicht, daß, so mächtig durch Gottes Gnade auch die Predigt des heimgegangen auf der Kanzel und im Leben gewesen, die Predigt seines Todes für alle Zeiten noch mächtiger sein und in der Kirche fortleben werde. Ein Jahr vor seinem Tode, grade an seinem Begräbnißtage. am 8. April, am Osterfeste, hatte er in einer Rede über die Worte: „Ich bin die Auferstehung und das Leben; wer an mich glaubt, wird leben, obgleich er stirbt“ jedesmal, so wie er die Namen der Patriarchen, der Propheten der Apostel, der Reformatoren und der Heiligen aller Zeiten genannt hatte, ausgerufen: „Sie sind nicht todt, sondern sie leben “, und damals nicht geahnt, wie ein Jahr später an demselben Tage viele seiner Zuhörer an seinem eigenen Grabe stehen würden. Nun standen sie am 8. April 1856 an seinem Grabhügel und sprachen, eingedenk jener Osterpredigt: „Er ist nicht todt, sondern er lebt!“ und mit diesem über Grab und Tod erhebenden Gedanken haben die Trauernden in der Zuversicht des Glaubens Adolf Monods letzte Ruhestätte verlassen.
Um Adolf Monod trauerte die ganze evangelische Kirche Frankreichs, trauerten in aufrichtiger Anerkennung seiner großen Gaben viele Katholiken – nannte ihn doch ein katholisches Blatt den größten Kanzelredner, den Frankreich jemals gehabt! – trauerte auch eine große Zahl evangelischer Christen in England, in der Schweiz und in Deutschland; denn Monods Name war schon damals weit über die Gränzen seines engeren Vaterlandes hinausgedrungen. Monod’s beredtes Wort aber ist, seitdem sein beredter Mund stumm geworden, nicht verklungen; im Gegentheil, soweit die Gläubigen in der evangelischen Kirche nach Belehrung und Erbauung auf Grund des göttlichen Wortes suchen, da finden sich auch Adolf Monod’s Reden im Original oder in der Übersetzung, und noch immer erweitern sich die Kreise, in denen das gute Wort eine gute Stätte findet. Die zwei Reden über das Weib, d. h. über die Bestimmung und den Beruf des christlichen Weibes, haben zuerst Monod’s Namen in alle Lande getragen; die fünf Reden über den Apostel Paulus gewannen ihm neue Verehrer, und es unterliegt wohl keinem Zweifel, daß viele andre gleich vortreffliche Reden des Verewigten erreichen werden, was er mit seinem Worte überhaupt bezweckte, nämlich dem Heilande Seelen gewinnen, das Evangelium als die Kraft Gottes erscheinen zu lassen, selig zu machen Alle, die daran glauben.
Während Monod, von seinen Zuhörern zur Veröffentlichung seiner Reden gedrängt, lange Zeit sich nur zur Herausgabe einzelner Reden bestimmen ließ, entschloß er sich im Jahre 1852, eine Sammlung seiner Kanzelvorträge zu veranstalten. Er kämpfte schon mit jenem schrecklichen, unheilbaren Leiden, als er im Juni 1855 die Vorrede zu dem ersten Bande schrieb, der die in Neapel und Lyon von 1825 – 1836 enthaltenen Reden enthielt. Der zweite Theil umfaßt die von 1836 – 1847 zu Montauban gehaltenen Reden; Monod hat sie seinen alten Schülern als ein neues Zeugniß seiner treuen Liebe zu ihnen gewidmet; der dritte Theil endlich beginnt mit den zwei zu Paris gehaltenen Antrittsreden, enthält überhaupt die in der Hauptstadt Frankreichs von 1847 an gehaltenen Reden. Außerdem sind aber noch eine nicht unbeträchtliche Zahl einzelner Reden erschienen, die in jenen drei Bänden keine Aufnahme gefunden haben; zu den Kanzelreden kommt außerdem hinzu das vortreffliche, viel gelesene und viel übersetzte Buch: Lucile oder das Lesen der Bibel.
In Deutschland ist das letzte Werk in zwei Uebersetzungen erschienen, ebenso die Abschiedsworte, während die zwei Reden über das Weib in mindestens sechs Ausgaben, von denen einige mehre Auflagen erlebt haben, verbreitet sind; die fünf großartigen Reden über den Apostel Paulus sind vom Consistorialrath Bonnet zu Frankfurt a. M. vortrefflich übersetzt; außerdem sind hie und da, in Bremen, Stuttgart und Potsdam, einzelne Reden herausgegeben worden.
Wir übergeben hiermit der Oeffentlichkeit eine Auswahl der vorzüglichsten Reden Monods. Wir haben uns in der Zusammenstellung nicht an die für uns bedeutungslose Reihenfolge der Jahre, in denen sie gehalten sind, gebunden, sondern das dem Inhalte nach Verwandte an einander gereiht. Die ersten Reden (Wen da dürstet, des Menschen Elend und Gottes Erbarmen) zeigen uns den erlösungsbedürftigen Menschen, die folgenden den erlösenden Gott und den auf Erden erschienenen Erlöser, wie Er für sie da ist und sie für Ihn; sodann lernen wir den in Glauben, Reue und Buße seinem Erlöser sich nahenden Menschen und das Leben des wiedergebornen Christen in den mannigfachsten Beziehungen kennen.
Die Uebersetzung hat mit aller Treue Monods Worte wiederzugeben gesucht, zugleich aber jene Treue zu vermeiden gestrebt, die weniger den Sinn und den Gedanken, als den Buchstaben des Originals zu übertragen sich bemüht. Monod deutsch reden zu lassen, ist oft sehr schwer; die deutschen und französischen Ausdrücke decken sich zu wenig; auch die beste Uebersetzung kann die Schönheit und Kürze des Originals nicht ganz erreichen. Jeder billige Beurtheiler wird der Uebersetzung jedoch hoffentlich das Zeugniß geben, daß ihr treuer Fleiß gewidmet ist. Wer aber den Vollgenuß der Worte Monod’s haben will, den weisen wir von unserer Uebersetzung auf das Original mit seiner einfachen Schönheit und Klarheit; der mit der theologischen Literatur Vertraute wird dann zugleich an vielen Stellen mit Freuden bemerken, wie Adolf Monod namentlich auch durch deutschen Geist und deutsche Forschungen in seiner Erkenntniß des Evangeliums wesentlich gefördert worden ist.
Wird man bei der Reichhaltigkeit unsrer deutschen homiletischen Literatur vielleicht die Uebertragung französischer Kanzelreden tadeln? Wird man sagen: Man solle doch erst in Deutschland kennen lernen, was Kant oder Schleiermacher über das weibliche Geschlecht gesagt haben, ehe man lese, was ein französischer Pastor über das Weib urtheile? Nichts verkehrter als eine solche Behauptung. Es handelt sich bei Adolf Monod gar nicht um eine französische Auffassung des Weibes oder der Religion, er will nicht Franzose sein und gleichsam ein französisches Christenthum lehren und predigen, die nationalen Elemente sind in ihm überwunden, sondern er ist ein Diener des für alle Völker und Zeiten immer sich gleich bleibenden, für alle Menschen gleich nothwendigen, und über alle Beschränktheit der Zeit und des Ortes erhabenen Evangeliums Jesu Christi.
Und so mag denn diese Sammlung mit den Worten in die Oeffentlichkeit treten, mit der A. Monod die Vorrede zu dem ersten Bande seiner gesammelten Reden schließt: „Möge Gott diese Reden zu Seiner Ehre dienen lassen!“ Möchten sie durch Gottes Gnade vielen Lesern den Weg des Friedens weisen; möchte aber auch der demüthige Grundsatz des treuen Knechtes Gottes immer mehr in Erfüllung gehen: „Er muß wachsen, ich aber muß abnehmen!“
Dr. Ferdinand Seinecke.
Quelle: Sechs Reden von Adolf Monod
mit einem biographischen Vorwort.
Aus dem Französischen
Bielefeld.
Verlag von Velhagen und Klasing.
1860