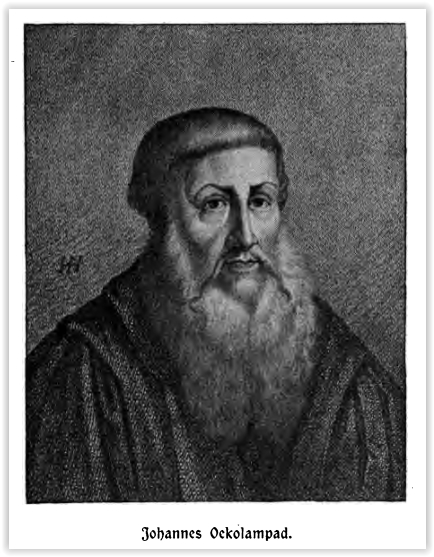Odilia
(gest. 13. Dezember 720)
„Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt mich getränket. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt mich beherbergt. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt mich besucht.“ (Matt. 25, 35. 36.)
Im schönen Elsaß, fünf Stunden südwestwärts von Straßburg, springt aus den Vogesen, die hier gegen den Rhein hin abfallen, eine hohe Bergkuppe hervor, von welcher man das ganze Land, einst ein Garten deutscher Erde, überschauen kann, bis jenseits über den Rhein, wo der Schwarzwald die prächtige Landschaft als dunkler, fester Hintergrund abschließt. Altes Gemäuer krönt den Scheitel dieser Kuppe, und man begreift es auf den ersten Blick, daß hier in alten Zeiten eine Warte und Waffenplatz gestanden, und die Ebene rund umher beherrscht hat.
Alte Chronisten erzählen von einem Allemannen-Herzog, welchen sie bald Ethico, bald Attich und Edelreich nennen, der habe um die Mitte des siebenten Jahrhunderts zuerst zu Oberehenheim im flachen Land gewohnt. Darnach aber habe er stolze Adler-Gedanken bekommen, uns sich mit großen Schätzen eine umfangreiche Burg auf die Kuppe gebaut. Da saß er nun in der Höhe mit seiner Gattinn, Berehsinda oder Bereswinda geheißen, und aus königlichem Blute entsprossen. Das war ein eiserner Herzog, Stolz in seinem Gemüth, Trotz und unbändigen Jähzorn, bis Gott ihm das steinerne Herz zerbrach. – Als er von seinem neuen Bergschloß aus, welches er „Hohenburg“ nannte, sein Herzogthum so weit, reich und sonnig zu seinen Füßen sich ausbreiten sah, bläheten stolze Zukunftsgedanken seinen Muth. Er gedachte, durch Bereswinde,, seine junge Gattinn, welche eben mit ihrem ersten Kinde ging, der Stammvater eines Fürstengeschlechtes zu werden, das die von ihm ererbte Macht mit dem Schwerte wahren und mehren werde.
Solches bewegte Ethico grade in seinem Herzen; da ward ihm die Botschaft von der Geburt seines ersten Kindes gebracht, und daß es nicht ein Sohn, sondern ein blindes Töchterlein sei. Darauf war er nicht gefaßt. Der getäuschte Fürstenstolz brachte sein Blut in Wallung. Er wähnte, sein Name sei beschimpft, und im Zorn solchen Wahnes befahl er, sein Kind, das seine Augen nicht sehen wollten, zu tödten. Da hatte Bereswinde schwere Angst um ihr armes, blindes Töchterlein. Sie vertraute es heimlich einer treuen Amme, daß sie es nicht weit von Hohenburg einer zuverlässigen Familie zur Erziehung übergebe, und trauerte öffentlich über den Abschied, als sei es gestorben. Aber nicht lange, so schien der Verberg in der Nähe des unholdigen Vaters nicht mehr sicher. So wurde es über die Berge geflüchtet in das Kloster Balma bei Besancon; da war eine Freundinn Bereswina’s Aebtissinn.
Hier empfing das verbannte Herzogskind bei der Taufe den Namen Odilia. Es erwuchs, und blühete still zum jungfräulichen Alter. Das Augenlicht wurde ihr durch Gottes Hülfe geschenkt. Aber noch heller und schöner erschloß sich das inwendige Auge, welches Glaube heißt, und die Herrlichkeit des Evangeliums und die Geheimnisse des Himmelreichs erschaut.
Bereswinde hatte unterdes vier Söhne geboren, und mit ihnen das Geheimnis von der verbannten Schwester getheilt. Da gedachte ihrer einer, der Hugo hieß, der Zorn des Vaters möchte nach so vielen Jahren verlöscht seyn, und ordnete heimlich die Rückkehr der geliebten Schwester an. Diese machte sich, begleitet von mehreren Klosterfrauen, auf den Weg zur Heimkehr. Eines Tages sah man einen Zug verschleierter Frauen gen Hohenburg zu Berg steigen. Der Herzog, da er sie nahen sah, frug, wer das sei? Hugo, freudig bewegt, daß nun die Stunde da sei, wo er das Entzücken der Mutter, und die versöhnte Liebe des Vaters zu sehen gedachte, antwortete fröhlich: sieh, das ist eure Tochter Odilia, unsere vielgeliebte Schwester, sie lebt, und kommt in die Arme des Vaters zurück..“ Aber der Herzog, indem er finsteren Blickes seinen Sohn einen Ungehorsamen schalt, war also ergriffen vom wilden Feuer des Zornes, daß er ihn mit einem Schwert erschlug. Da war die Freude in groß Leid verkehrt. Und Odilia hielt weinend ihren Einzug über den Leichnam ihres treuen Bruders.
Doch, als nun der Herzog inne ward, was er in der Blindheit seiner Leidenschaft angerichtet, da brach sein trotziges Herz. Liebreich nahm er die Tochter auf. Aber sie sollte fortan als Prinzessinn in der herzoglichen Hofhaltung glänzen, und er gedachte, sie einem Fürsten zur Gattinn zu geben. Aber Odilia war stillen, schüchternen Herzens abhold dem weltlichen Gepräge, und hatte die Gewißheit, daß Gott sie zu andern Dingen und Diensten geschickt gemacht habe. Sie bat flehentlich, der Vater möge von seinen Wünschen absehen. Endlich überwand die sanfte Tochter den starren, starken Vater; ja, je mehr und mehr geschah es, daß er durch die Demuth und kindliche Ehrerbietung, und durch ihre Gebete unter das sanfte Joch Christi gar gefangen wurde. Da entwichen alsbald die düsteren Schreckensgeister, welche den Herzog seinem Haus und Land unheimlich gemacht hatten, und der fromme, freundliche Friede lagerte sich in der Hohenburg, und breitete seine Flügel mild über das ganze Regiment des Fürsten. Odilias Liebesfeuer entzündete rings die Herzen der Ihrigen. Der Vater räumte ihr und ihren Frauen einen Theil der Burg ein, der so erweitert und eingerichtet ward, daß 130 Jungfrauen aus den edeln Geschlechtern des Landes dort Aufnahme finden konnten, und unter ihrer Leitung standen. Diese Schaar war in 7 Chöre getheilt; jeder Chor hatte seinen besonderen Betsaal. Da erschollen zu gewissen Stunden heilige Gesänge, Gebete und Verkündigung des göttlichen Wortes. Vor dem Thor war eine Wohnung für 12 Geistliche erbaut, welche als Chorherren die gottesdienstlichen Uebungen zu leiten hatten.
Sie richtete sich in dieser Einrichtung nach der Anweisung einer der evangelisch gesinnten brittischen Nonnen, als ihrer Lehrerinn.
Das war nun nicht ein peinlich in äußern Satzungen und Regeln eingeschnürtes Klosterleben, dabei der Geist stolz, träg und selbstgerecht wird, sondern aus dem Evangelium erwachten, frei und frisch. Es wird erzählt, daß Odilia nicht Einen Tag verleben mochte, ohne mit ihren Stiftsfräulein in der heil. Schrift gelesen zu haben, diesem alleinigen Born gesunder Frömmigkeit. So hielt sie denn auch mit fester Hand und recht evangelischem Verständniß alles Zumuthen fern, welches ihre Stiftung auf jene entsetzlichen Abwege des römischen Klosterwesens hätte verlocken können. Einst wurde eines ihrer Stiftsfräulein nach dem Heiligenschein überflüssiger Verdienste lüstern; die täglichen Andachtsübungen schienen ihr zu gewöhnlich, zu wenig auszeichnend; sie begehrte die Einführung strenger Kasteiungen. Odilia wies sie mit den Worten ab: „Es sei nur dann nützlich, sich Entbehrungen aufzulegen, wenn es zur Reinigung des Herzens, zur Heiligung des Lebens, und zur Tröstung der Seele beitrage Die Erfüllung der nächsten und natürlichsten Pflichten, deren Versäumnis Sünde sei, biete hinlängliche, ja fast zu schwere Arbeit. Sie deutete auf die großen Schwierigkeiten hin, die täglichen Bedürfnisse, z. B. das Wasser, auf den steilen Wegen zur Hohenburg zu schaffen. Sie wollte sich hüten, ihren Nachfolgerinnen unerträgliche Lasten aufzubürden, und deren Tadel zu verdienen, dagegen aber bereit bleiben, Alles für den gekreuzigten Heiland zu thun.“
Und das Licht, das sie vor den Leuten leuchten ließ, zeigte hell, wie sie diese letzten Worte verstanden wissen wollte, nämlich aus der Rede des Herrn: „Ich bin hungrig gewesen, und ihr habt Mich gespeiset. Ich bin durstig gewesen, und ihr habt Mich getränket. Ich bin ein Gast gewesen, und ihr habt Mich beherberget. Ich bin nackend gewesen, und ihr habt Mich bekleidet. Ich bin krank gewesen, und ihr habt Mich besuchet. Ich bin gefangen gewesen, und ihr seid zu Mir gekommen.“
Ihre Verwandten, da sie die Weisheit, Treue und Freudigkeit ihrer Liebe sahen, legten alle von ihren Reichthümern große Schätze in ihre Hand; ja etliche ihr ganzes Erbtheil. Alsbald besaß Odilias Stift nicht bloß bewegliches Silber und Gold, sondern auch Wälder, Ländereien und Gehöfte.
Aus ihren Zellen und Betsälen, von Gottes Wort her, brauchen die Stiftsfrauen frischen Muth zu Leben und Arbeit. die nächste Aufgabe Odilias war Unterrichtung und sorgfältige Erziehung der ihrer Pflege anvertrauten Jungfrauen. Dann aber verlief aus dem Einen tiefen, heiligen Quell der Christusliebe ihre Beschäftigung in unzählige Bächlein des Dienens und Helfens. Zur Hohenburg, vordem als des Landes Zwang und Drang mit Furcht und Zittern angesehen, hub nun rings aus den Thalen und Ebenen alles Gepreßte und Elende seine Augen auf als zu dem Berge, von welchem ihm Hülfe kam, und als zu einer Burg Gottes.
Und da Odilia gewahrte, wie sauer es manchen der Hülfesuchenden ward, seinen durch Alter oder Elend siechen Körper den jähen Berg hinauf zu schleppen, und dabei gedachte, Viele möchten wohl drunten vergebens schmachten, gleich wie der lahme Mensch am Teich Bethesda, sprach sie: „Wohlan, so wollen wir zu euch blind kommen!“
Alsbald sah man am Fuß des Berges viele Werkmeister und Bauleute mit großem Fleiß beschäftigt. Zuerst wuchs eine schöne Kirche aus dem Boden; denn man achtete in den alten Zeiten das Haus des Herrn als den Kern und Mittelpunkt, und als den lebendigen Quell aller menschlichen Ansiedelung. Darnach erstand eine Herberge für Fremdlinge und Pilgrime, denn Gastfreiheit, das heißt: Darbietung süßer Heimathlichkeit, ist eine Tugend, von dem Herrn und seinen Aposteln hoch gerühmt. Darnach ward den Kranken, Wunden und Altersschwachen ein Siechhaus erbaut. Darnach den Hungernden, Dürstenden, Nackten und Obdachlosen ein Armenhaus. Und es geschah, was Jakob im Träume sah, die Engel stiegen auf und nieder von der Hohenburg zu diesen Hütten der Barmherzigkeit, Odilia voran in Arbeit und Aufopferung. Sie führte die Stiftsfräulein täglich hin, lehrte sie die Kranken und Armen leiblich und geistlich pflegen, las den Kranken aus der heil. Schrift vor, pflegte sie auch persönlich, und ging darin so weit, daß sie einst für einen Aussätzigen selbst die Fürsorge übernahm, ihm Speise bereitete, und dann in den Mund gab, ihn umfaßte und wärmte, und mit Gebet und Thränen für ihn um Geduld und um Genesung zu Gott flehte. Und ihr Gebet wurde erhöret; der Aussätzige wurde gesund. Und endlich, da sie sah, wie viel Aufwand an Zeit und Beschwernis durch dieses stetige Ab- und Zugehen erwachte, krönte sie das Werk durch Erbauung eines Mutterhauses, des Klosters, welches sie Niedermünster nannte, im Gegensatz zu Hohenburg. Nun hatten die dienenden Frauen festen, bequemeren Sitz ganz nahe bei ihren Pflegebefohlenen.
Mit klugem Sinn hielt sie alles Eifersüchteln und Hadern um Mein und Dein von diesen ihren beiden Stiftungen fern, und theilte deßhalb auch ihr reiches Erbe, nämlich 25 Landgüter und eben so viel Dörfer, aus welchem Zehnten und Gefälle zu beziehen waren, genau zwischen Hohenburg und Niedermünster. Nur dem Wetteifer in der Liebe gestattete sie freie, aber grade Bahn. Sie wußte mit ihrer frommen, willenskräftigen Begeisterung, wie mit starken Mutterarmen, ihre schwächeren jüngeren Genossinnen, wenn sie in die Alltäglichkeit zu versinken drohten, empor zu heben. Einst, als sie mit diesen vor ihrer Hohenburg auf einen Felsenvorsprung herausgetreten war, und ein weiter, herrlicher Gesichtskreis sich ihnen erschloß, deutete sie mit der Rechten hinaus, und sprach: „Sehet, meine Schwestern, diese reiche Ebene mit ihren Städten und Dörfern, wo ihr vormals lebtet nicht ohne Befleckung des Leibes und der Seele! Der Fels, auf dem ihr stehet, trennt euch jetzt von derselben. Er ist euch ein Bild des himmlischen Berges, den ihr erklimmen sollt; dort seid ihr frei von den brennenden Sonnenstrahlen, von dem rauhen Nordwind, Regen und Wintersturm; dort ist ewiger Frühling!“
Zur Zeit Odilias hielten sich an vielen Punkten der obern Rheingegenden brittische und schottische Sendboten des Evangeliums auf, welche reiner von Menschen- Satzungen, freier von priesterlicher Herrschaft, und lauterer aus der Bibel heraus, als es von Rom her geschah, das Christenthum lehrten und pflanzten. Diese pflegten nicht selten in die Kirche zu Niedermünster zu gemeinsamen Berathungen sich zu versammeln. Ihr Einfluß ist in Odilias Hochschätzung der Bibel und in der evangelischen Gestaltung ihrer Stiftungen zu erkennen. Auch bei ihrer Erziehung wirkten sie schon segensreich auf sie ein. In ihrem Vaterlande, in Schottland und Irland, waren christliche Frauen zu kirchlichen Dienstleistungen, als Pförtnerinnen an den Ein- und Ausgangsthüren der Kirchen für die Frauen, als Handlangerinnen bei weiblichen Taufen, also zum Diakonissen-Dienste und zu Werken der Barmherzigkeit schon im 5. Jahrhundert angestellt.
In der Kirche zu Kildare, in Irland, liegt auf derselben linken Seite, wo die Eingangsthüren der Wittwen und Jungfrauen auf ihre abgesonderten Kirchenplätze sich befanden, die h. Brigitte, Nichte des h. Patricius, neben dem Altare begraben, wo gegenüber auf der rechten, der Männerseite, der Bischof Conlaeth seine Grabstätte fand. Sie starb im Jahr 520; ihr Gedächtnistag ist am 1. Februar. Die Kranken- und Armenhäuser und Pilgerherbergen, welche die schottischen und irländischen Geistlichen, nach dem Vorbild ihrer Heimath, häufig in Deutschland und Gallien errichteten, nannten Sie „Brigitten-Häuser.“ Ein solches Brigitten-Haus war auch in Mainz von den Schotten in der Altmünstergasse neben der Paulskirche, der Schottenpfarrkirche, errichtet. Später findet sich auch eine besondere Brigitten-Kapelle dabei, und das Brigittenhaus wird das Elendhaus genannt.
Vierzig Jahre lang leitete Odilia die von ihr gegründeten Anstalten, von 680 bis 720. Während der zehn ersten Jahre lebten ihre Aeltern noch bei ihr. Der alte Herzog Ethico starb 690, neun Tage später die Mutter Bereswinda. Diese Tochter war der Friedensengel ihres Lebens.
Ihr Vater und ihre Mutter kannten am Abend ihres Lebens keine schönere Arbeit, als ihr in ihren Liebeswerken Handreichung zu thun. Und ihre Schwester Roswinde, wie ihre drei Nichten Attala, Eugenie und Gundelinde gaben sich selbst dem Liebeswerk Christi, unter Odilias Leitung, hin. Sie wurden alle später Aebtissinnen. Mehrere ihrer Brüder und Neffen widmeten sich theils selbst der Kirche, theils stifteten sie Klöster in evangelischem Geiste, unter Einfluß der schottischen Geistlichen, und Herbergen für Fremde und Wanderer, eine der letzteren, Murbach, mit Hülfe des Bischofs Pirmin.
Als Odilia durch Körperschwäche an das Herannahen des Todes erinnert wurde, ließ sie sich in die Johannes-Kapelle, oder den Johannes-Saal auf Hohenburg bringen, rief alle Schwestern, und sprach, als sie dieselben um sich versammelt sah, zu ihnen ihre letzten Worte voll mütterlicher Liebe und Ermahnung. Alsdann ließ sie sich das heil. Abendmahl unter beiderlei Gestalt reichen, und entschlief bald darauf selig in ihrem Herrn. Sie starb den 13. Dezember 720. Später wurde sie, als der Heiligendienst, der schottischen Abwehr ungeachtet, Ueberhand nahm, zu einer Heiligen gemacht, und als Schutzpatronin des ganzen Elsasses angerufen. Ihre Klöster mußten sich, ebenso wie die Männer-Klöster, unter dem Zwang von Bonifacius und den ihm befreundeten karolingischen Machthabern, der Benedictiner-Regel unterwerfen. Ja, die Benedictiner behaupteten selbst, Odilia wäre Benedictinnerinn gewesen. Aber diese Schülerinn der Britonen und Schotten, die fleißige Leserinn der heil. Schrift und Thäterinn aller Werkheiligkeit, trägt schon in ihrem weißen Gewande, und in ihren herabhängenden Haarflechten, wie man sie auf dem Bilde sieht (Das Tragen von Haarzöpfen war zugleich ein Zeichen königlicher Abstammung.), einen solchen Contrast mit dem dunkeln Gewande und geschornem Haupte der Benedictinerinnen, daß man sieht, obige Behauptung ist eine grobe Fälschung de Geschichte. Zum Überfluß findet sich sogar noch eine päpstliche Bulle vor, welche die „Zoph-Nunnen“ verbietet, ein Zeichen, daß Odilia sich nicht unter das knechtische Joch Roms hatte fangen lassen.
Als Maria das Alabaster-Gefäß über dem Haupte des Heilands in Bethanien zerbrach, da füllte der Geruch der köstlichen Narde das ganze Haus. So liegen Hohenburg und Niedermünster längst in Trümmern; aber das Leben der Liebe, welches darinnen waltete, duftet köstlich, und erquickt bis auf diesen Tag. Und Odilia leuchtet, als eine fürstliche Diakonissinn, ihren deutschen Landsmänninnen zum liebsten Vorbilde für alle Zeit.
Dr. Theodor Fliedner,
Buch der Märtyrer,
Verlag der Diakonissen-Anstalt zu Kaiserswerth,
1859