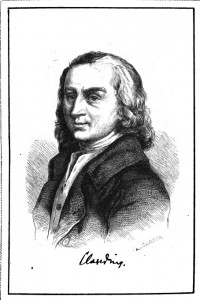Erlitt den Märtyrertod zu Rom 5. Septbr. 1553.
1. Giovanni Mollios Herkommen und Jugendrichtung.
Vor unserem Geist wandelt in der Erinnerung vorüber die herrliche Schar evangelischer Märtyrer Italiens aus dem Zeitalter der Reformation, die alle, wie Paulus (Gal. 6,17) die Mahlzeichen des Herrn Jesu an sich tragen. An der Spitze derselben begegnet uns, geschmückt mit dem Kranz des Märtyrers, der ernste Franziskaner Giovanni Mollio, dessen Lebens- und Leidensbild wir hier zuerst zeichnen wollen.
Das schöne Toskana, das so viele ausgezeichnete Männer unter seinen Söhnen zählt, ist seine Heimat, Montalcino, unweit Siena, sein Geburtsort, nach dem er, wie es die Italiener zu tun pflegen, gewöhnlich genannt wurde. Sein Geburtsjahr kann nicht mehr genau ermittelt werden; indessen muss dasselbe entweder auf den Schluss; des fünfzehnten oder auf den Anfang des sechzehnten Jahrhunderts fallen. Seine Eltern waren arm und daher war auch Armut das Erbteil, das ihm von ihnen zufiel; aber dagegen hatte ihn Gott mit reichen Geistesgaben gesegnet. Frühzeitig bekundete er auch einen ernsten Sinn und eine heiße Begierde nach wissenschaftlicher Bildung und nach christlicher Vervollkommnung. Um dieses doppelte Ziel sicherer zu erreichen, trat er in den Franziskanerorden strenger Observanz.
2. Giovanni Mollios Lehrjahre in Brescia, Mailand und Padua.
Mit großem Ernste und Eifer lag er nun sowohl der Erfüllung seiner Ordenspflichten als dem Studium der Wissenschaften ob und erwarb sich das durch in hohem Grade das Zutrauen seiner Ordensvorsteher. In Folge dessen wurde er, als er noch kaum die Schwelle des Jünglingsalters überschritten, zum Professor an der Hochschule zu Brescia befördert. Hier, wie später in Mailand, erwarb er sich sowohl durch seine gründlichen und vielseitigen Kenntnisse als durch seine glänzenden Lehrgaben den Ruhm eines ausgezeichneten Lehrers. Da dem Franziskanerorden, zumal durch Sixtus IV. (1471 – 84), der selbst Mitglied desselben gewesen, große Vorrechte verliehen waren, namentlich überall, selbst ohne Begrüßung des Ortsgeistlichen, die Seelsorge auszuüben und als öffentlicher Lehrer aufzutreten; so eröffneten sich nun dem reichbegabten Professor glänzende Aussichten auf wissenschaftlichen Ruhm und auf kirchliche Ehrenstellen. Aber das Herz des ernsten Franziskaners ward um diese Zeit von einem Geisteszug ergriffen, der ihn mehr nach den Tiefen christlicher Erkenntnis und evangelischen Glaubens zog, als nach den Höhen des Ruhms und der Ehrenstellen. Wie der gleiche Odem Gottes den Frühling bringt sowohl nach den lieblichen Fluren Italiens, wo die Zitronen blühen, als nach den eichenumkränzten Ebenen Deutschlands und nach den Hochtälern der Schweizeralpen, so war es auch der gleiche Geist des Herrn, der uns „in alle Wahrheit leitet,“ welcher im Zeitalter der Reformation die Herzen derjenigen, welche sich nach der Erkenntnis der Wahrheit sehnten, mit wunderbarer Macht ergriff und zu dem gleichen Ziel, zum Glauben an Christum, aus dem allein das Heil erblüht, hinzog. Von diesem Geisteszuge ward auch Mollio, wie viele andere Mitglieder seines Ordens, in seinem ernsten Streben nach Erkenntnis der Wahrheit und nach dem Frieden der Seele, tief ergriffen; indem er die schmerzliche Erfahrung machen musste, dass weder das raue Franziskanergewand noch die pünktliche Erfüllung der Ordenspflichten die nach der Seligkeit dürstende Seele zu beruhigen und sie ihres Heils zu versichern vermögen. Auch das Studium der neu auflebenden klassischen Literatur gewährte ihm den ersehnten Seelenfrieden nicht; wohl aber wurden ihm unter dem Zuge des Geistes die herrlichen Schriftwerke der griechischen und römischen Weisheitsfreunde Wegweiser zu Christo und zu den Schriften des neuen Testamentes hin, die von ihm zeugen. Der Geist, welcher die Umgebung des jungen Professors durchwehte, war auch ganz geeignet, das Werk der Gnade in seinem Inneren zu fördern. In Brescia, der Vaterstadt des evangelischen Wahrheitszeugen Arnold, wie in Mailand, der stolzen Hauptstadt der Lombardei, ja durch ganz Oberitalien hatte sich auch durch das Mittelalter hindurch, eine dem Evangelio freundlich zugewandte religiöse und kirchliche Richtung erhalten. Unter schweren Leiden der Kriege, welche im Anfange des sechzehnten Jahrhunderts über diesen herrlichen Ebenen sich zerstörend und verwüstend herüber und hinüber wälzten, hatte sich diese Richtung bei vielen ernsten Gemütern zur Überzeugung gestaltet, dass nur durch die freie Predigt des Evangeliums das schwere Unglück, das auf dem Land lastete, gewendet, und dass den seufzenden Bewohnern desselben, wie allen Menschen, allein aus dem Glauben an Christum das Heil erblühen könne. So schrieb im Jahre 1525 der Augustiner Egidio a Porta von Como an den Reformator Huldreich Zwingli in Zürich unter Anderem: „Mailand und sein ganzes Gebiet sind durch die unaufhörlichen Kriegszüge völlig verarmt. Selbst die, welche sonst ein mäßiges Vermögen besaßen, sind an den Bettelstab gebracht und darben, geschweige denn die Unzahl derer, die schon vorher arm waren. Nicht zu zählen sind die Weiber, welche sich aus Not der Schande ergeben. So schwer lastet Gottes Hand auf diesem Volk, dass aus Verzweiflung alles erdenkliche Unrecht begangen wird. Aber durch Gottes Fügung kannst Du unser Retter werden. Schreibe an den Herrn von Mailand und ermahne ihn, nötigenfalls auch drohend, auf Erlösung seiner Untertanen vom äußeren Elend und vom Geistesdruck bedacht zu sein. Jenes, indem er den Kahlköpfen ihr Geld, das sie doch nur übermütig macht, wegnimmt, dieses, indem er es verschafft, dass jeder, so weit es ihm verliehen, das lautere Wort Gottes ungescheut predigen darf; zumal wenn er bereit ist, über seine Lehre nach Gebühr Rede zu stehen. So wird dann die Kraft des Antichristen schnell dahin fallen!“
Der rege Handelsverkehr zwischen den Städten der Lombardei und denjenigen der benachbarten Schweiz und Deutschlands vermittelte auch die Bekanntschaft mit der evangelischen Lehre, die in Zürich, wie in Wittenberg mit so großem Nachdruck und Segen verkündigt wurde, sowie mit den Schriften der Reformatoren. So bildeten sich schon seit 1524 in Mailand und in anderen Städten der Lombardei und Venedigs kleine oder größere evangelische Gemeinschaften, welche in der Stille sich versammelten und das neue Testament und einzelne Schriften der Reformatoren lasen und sich daraus mit einander erbauten. Diesen evangelischen Kreisen, in welchen der gleiche Geist wehte, der auch sein Inneres ergriffen, schloss sich Mollio an, sie durch sein gründliches Wissen fördernd und von ihnen selbst im Glauben gefördert. Je mehr sich Mollio in das Studium der Schriften des neuen Testamentes und namentlich der Paulinischen Briefe vertiefte, desto klarer und mutiger verkündigte er auch in seinen öffentlichen Vorträgen die Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben an Christum. Von Mailand ward Mollio durch seine Ordensvorsteher für kurze Zeit nach Padua versetzt, wo er ebenfalls einen Kreis von Freunden und Beförderern der evangelischen Wahrheit traf, dem er sich anschloss.
3. Giovanni Mollio in Bologna, sein Sendschreiben an den kursächsischen Gesandten J. von Planitz.
Am Ende des Jahres 1532 kam dann unser Franziskaner-Professor auf Geheiß seiner Oberen nach Bologna. Obgleich damals der aus der deutschen Reformationsgeschichte hinlänglich bekannte Kardinal Campeggio dieser Stadt und Legation vorstand und seinen einst Carl V. erteilten Rat, „das giftige Gewächs der evangelischen Kirche mit Feuer und Schwert zu vertilgen“ in dieser Stellung selbst eifrig betätigte, so fand sich doch auch in dieser Stadt und namentlich unter den Professoren der Hochschule ein Kreis eifriger und mutiger Freunde der evangelischen Wahrheit, welchem sich Mollio anschloss und deren Gesinnungen und Hoffnungen wir aus ihren eigenen Worten kennen lernen wollen.
Mit gespannter Teilnahme verfolgten die Evangelischen in Italien die Entwicklung der evangelischen Kirche in Deutschland und in der Schweiz. Bange ward es ihnen für sie, als Carl V. 1530 den berühmten Reichstag zu Augsburg in der Absicht eröffnete, den Frieden und die Eintracht in der Kirche durch die Unterdrückung der Predigt des Evangeliums wiederherzustellen. „Ganz Italien,“ schrieb Paolo Roselli aus Venedig an Melanchthon, „sieht mit ängstlicher Erwartung dem Ausgang Eurer Versammlung entgegen.“ Freudig atmeten sie wieder auf, als die Kunde über die Alpen zu ihnen gelangte, die evangelischen Fürsten und Lehrer haben mutig und mit solchem Erfolge die evangelische Wahrheit verteidigt, dass der Kaiser jetzt nicht mehr daran denkt, sie zu unterdrücken, sondern vielmehr den Entschluss gefasst habe, ein allgemeines Konzil zu versammeln, um die längst ersehnte und vielseitig geforderte Reformation der Kirche an Haupt und Gliedern durchzuführen. Als Carl V. daher wieder aus Deutschland nach Italien zurückgekehrt war und mit Clemens VII. in Betreff der Versammlung dieses Konzils in Bologna eine Unterredung hielt, da schien den Evangelischen Italiens die Erfüllung ihrer Hoffnung nahe gerückt. Zu dieser Zeit erschien als Gesandter des Kurfürsten von Sachsen bei Carl V. Johann von Planitz und zwar, wie in Italien allgemein geglaubt wurde, mit dem Auftrag, den Kaiser zu bestimmen, beim Papst die beförderliche Versammlung dieses Konzils auszuwirken. Indem auch die Evangelischen in Bologna diesem Gerücht Glauben schenkten, wandten sie sich an Planitz in einem Schreiben, das wohl der Feder Mollios entflossen sein dürfte, und dem wir zur Kennzeichnung der Gesinnungen und Hoffnungen dieser Männer einige Stellen entlehnen wollen. Nach Erwähnung oben bezeichneten Gerüchtes schreiben sie an den kurfürstlichen Gesandten: „Ist die Sache, wie wir gerne glauben wollen, wahr, so erstatten wir Euch Allen den besten Dank, Euch selbst, weil Ihr Euch bemüht, in dieses Land Babels zu kommen, Eurem Deutschland, weil es eine Kirchenversammlung fordert, und ganz besonders Eurem evangelischen Fürsten, der das Evangelium und den wahren Glauben so eifrig verteidigt. Denn nicht zufrieden, seinen Sachsen und Deutschen Christi Gnade und Wahrheit wieder gegeben zu haben, bestrebt er sich, dasselbe Glück auch England, Frankreich, Italien, Spanien und anderen Ländern zu verschaffen. Wir sind vollkommen überzeugt, dass Euch für Euch selbst gar wenig daran liege, ob die Kirchenversammlung berufen werde oder nicht. Wir sahen ja schon, dass Ihr als edle und treue Christen das tyrannische Joch des Antichrists abgeschüttelt habt. Eure Rechte und heiligen Privilegien auf das freie Königreich Christi habt Ihr gesichert. Demnach könnet Ihr, wo und wie es Euch gefällig ist, öffentlich lesen, schreiben und predigen, die Geister der Propheten hören und sie beurteilen der apostolischen Regel gemäß. Wir Wissen auch, dass Ihr, weit entfernt über die gehässige Anklage der Ketzerei Euch zu ärgern und zu betrüben, vielmehr Euch glücklich schätzen und Euch freuen würdet, wenn Ihr von Allen zuerst für den Namen Jesu Christi Tadel, Schmach, Einkerkerung, Feuer und Schwert erdulden müsstet. Hieraus erkennen wir deutlich, dass Eure Forderung einer Kirchenversammlung keineswegs einen einseitigen Vorteil für Deutschland bezweckt, sondern, dass Ihr, getreu dem Rat der Apostel, das Interesse und Heil anderer Völker im Auge habt. Daher bekennen sich auch alle Christen Euch zu wahrem Dank verpflichtet, und, namentlich wir Italiener, indem wir als nächste Nachbarn des Mittelpunktes der Tyrannei das Glück Eurer Befreiung beneiden müssen, obgleich wir den Tyrannen selbst von Herzen lieben.“
Indem sich dann im Schreiben die Hoffnung ausgedrückt findet, Planitz werde sich ernstlich beim Kaiser für die Berufung des längst ersehnten Konzils verwenden, fährt dasselbe also fort: „Dieses kann Euch wohl nicht missglücken, indem Se. Majestät genau weiß, dass die frömmsten, gelehrtesten und berühmtesten Männer ganz Italiens und besonders Roms sehnlichst ein solches Konzil herbeiwünschen. Wir sind ferner vollkommen überzeugt, dass diese Männer, sobald sie den Zweck Eurer Sendung erfahren, Euch freudig entgegenkommen werden.“
„Endlich hoffen wir, dass man es als sehr vernünftig und der Anordnung der Apostel und Kirchenväter gemäß finden wird, dass man den Christen die Freiheit gewähre, ihre Glaubensbekenntnisse gegenseitig zu prüfen, weil die Gerechten nicht durch die Werke Anderer, sondern durch ihren eigenen Glauben leben, sonst würde der Glaube nicht mehr Glaube sein, noch die Überzeugung, die durch Gottes Geist in unseren Herzen gewirkt wird, Überzeugung genannt werden können, sondern es wäre vielmehr ein gewaltsam auferlegter Zwang, der, wie jeder einsieht, durchaus nichts zur Seligmachung beitragen oder nützen kann. Allein, wenn die Bosheit des Satans noch immer fortwüten sollte, diese Wohltat uns vorzuenthalten, so wird man doch mindestens den Geistlichen und Laien gestatten, Bibeln zu kaufen, ohne gleich der Ketzerei beschuldigt, oder die Aussprüche Christi und des heiligen Pauli anzuführen, ohne gleich mit dem Schimpfnamen Lutheraner beschwert zu werden. Leider haben wir genug Beispiele eines solchen abscheulichen Verfahrens, und wenn dieses nicht ein Zeichen der Herrschaft des Antichrists ist, was ist es denn anders, wenn man sich den Vorschriften der Gnade und der Lehre, dem Frieden und der Freiheit Christi so offenbar widersetzt, sie mit Füßen tritt und verdammt?“
Dieses Schreiben ist ein schönes Denkmal der glaubenstreuen und mutigen Gesinnung, welche die Evangelischen Italiens im Zeitalter der Reformation beseelte. Genährt und gefördert wurde diese evangelische Richtung durch das Lesen der heiligen Schrift, sowie der Schriftwerke der deutschen und schweizerischen Reformatoren, die in Italien meistens unter erdichteten Namen verbreitet wurden. Auf Mollio scheint namentlich Bullingers Schrift: „Über den Ursprung der Irrlehre von der Messe und von der Anrufung der Heiligen“ einen tiefen Eindruck gemacht zu haben, indem er sich in einem Gespräche über diese Schrift mit seinem Freunde Zanchi schließlich also äußerte: „Kaufe Dir dieses Buch, und falls Du kein Geld hast, so reiß Dir lieber ein Auge aus und gib es dafür und lies dann das Buch mit dem anderen Auge.“ – In Bologna las und erklärte Mollio unter großem Beifall seiner Zuhörer die Briefe des Apostels Pauli, die ihm vor allen Schriften des neuen Testaments lieb und teuer geworden waren, weil auch durch seine Seele, wie durch die des großen Apostels, der Riss zwischen Gesetz und Gnade sich schmerzlich vollzogen hatte. Da aber die von Paulo gelehrte Rechtfertigung allein aus dem Glauben mit der päpstlichen Lehre vom Verdienste der Werke, vom Ablass und vom Fegefeuer im Widerspruch steht, so erfuhren auch die Vorlesungen Mollios bald heftigen Tadel von Seite der päpstlich gesinnten Partei. Namentlich glaubte sich ein gewisser Cornelio, Professor der Mathematik, berufen, die von Mollio gelehrte Rechtfertigung aus dem Glauben bestreiten zu müssen. Von diesem aber in einer öffentlichen Disputation mit leichter Mühe überwunden, verklagte Cornelio seinen Gegner in Rom wegen Verkündigung und Verbreitung von Irrlehren. Paul III. (1534-49) hatte jedoch Männer zu Kardinälen ernannt, welche selbst der Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben beipflichteten. Dieses gilt namentlich von den Kardinälen Gaspar Contarini, der in einem besonderen Traktat diese Lehre entwickelt hat, sowie von Reginald Polus und Jacob Sadolet. Unter dem Einfluss dieser trefflichen Männer ward Mollio, der in Rom sich sehr freimütig ausgesprochen und verteidigt hatte, wieder nach Bologna mit dem Entscheid entlassen: „Die von ihm vorgetragene Lehre sei zwar schriftgemäß und wahr, dürfe aber einstweilen noch nicht ohne Nachteil für den römischen Stuhl verkündigt werden. Er solle daher die Erklärung der Paulinischen Briefe unterlassen und dagegen aristotelische Philosophie lesen.“ Aber Mollio fuhr fort, die ihm teuer gewordene Lehre von der Rechtfertigung aus dem Glauben auch in diesen Vorlesungen vorzutragen; daher wirkte der Kardinallegat Campeggio beim General der Franziskaner aus, dass er 1538 nach Neapel in das Kloster San Lorenzo als Lektor versetzt wurde.
Diese Versetzung gereichte aber keineswegs der evangelischen Bewegung zum Nachteil, wie es Campeggio beabsichtigt hatte. Den Evangelischen zu Bologna konnte Martin Bucer in einem Briefe vom 10. Sept. 1541 seine Freude äußern: „Dass ihre Zahl sich täglich mehre und sie auch immer mehr in der Erkenntnis Christi wachsen, so dass auch viele Andere durch sie zu dieser Erkenntnis geführt werden.“
4. Giovanni Mollio in Neapel als Mitglied der „seligen Gesellschaft“ des Juan Valdez.
Mollio ward auch selbst durch seine Versetzung nach Neapel in seiner evangelischen Richtung sehr gefördert. Hier begann seit 1536 namentlich bei den Gebildeten der höheren Stände eine Erweckung zu einem christlichen Lebensernst, wie die christliche Kirche ihn nur in Zeiten ihrer schönsten Entwicklung aufweist. Diese religiöse Erweckung war die Frucht der in der Stille betätigten, so gesegneten Wirksamkeit des edlen Spaniers Juan Valdez, der seit 1536 das Amt eines Sekretärs des Vizekönigs bekleidete. Schon in Spanien hatte sich Valdez mit den Schriften der deutschen Mystiker, welche die seligen Geheimnisse des Lebens in der Gemeinschaft mit Christo schildern, bekannt gemacht und namentlich das herrliche Buch „Von der Nachfolge Christi“ und einzelne Schriften Taulers in seine Muttersprache übersetzt. In Deutschland, wohin er im Gefolge Carls V. gekommen war, hatte er die Schriften der Reformatoren kennen gelernt, sich mehrere davon gekauft, und sie mit nach Neapel gebracht, wo ihm 1536 die Stelle eines Geheimsekretärs des Vizekönigs verliehen ward. Aus diesen Schriften hatte er die Lehre von der Rechtfertigung allein aus dem Glauben an Christum geschöpft und sie mit der ganzen Glut seiner schönen Seele erfasst. Dabei erfüllte ihn, der sich, wie ein Zeitgenosse von ihm bezeugt, „von Gott zum Seelsorger der höheren Stände berufen fühlte,“ ein apostolischer Eifer, auch Andere für die gleiche Glaubens- und Lebensansicht zu gewinnen, aus der ihm der Friede der Seele erblühte. So vereinigte er bald einen Kreis ausgezeichneter Männer und Frauen, die er durch tiefsinnige Unterredungen in die Geheimnisse des Glaubens an Christum und eines in seiner Gemeinschaft geführten Lebens einweihte. Bald versammelten sich diese Freunde der evangelischen Wahrheit in der Wohnung des Valdez im Palaste des Vizekönigs, bald in Vittoria Colonnas Landhaus auf der lieblichen Insel Ischia, bald in der Villa Casertas in der Terra di Lavoro, um sich an den Gesprächen dieses außerordentlichen Mannes zu erbauen, „der,“ wie ein Zeitgenosse von ihm schreibt, „seinen schwächlichen Körper nur mit einem kleinen Teil seines Geistes regiert; mit dem besten und reinsten Teile aber gleichsam außer dem Leibe stets zur Betrachtung der göttlichen Wahrheit erhaben war.“ Mit großem Scharfblicke wusste Valdez die Männer und Frauen herauszufinden, in welchen sich die Bedürfnisse des Glaubens regten und der Zug des Herzens nach Christo hin sich kund tat, und solche in den Kreis seiner „seligen Gesellschaft“ hereinzuführen. So ward auch Mollio, wie seine beiden berühmten toskanischen Landsmänner Bernardino Occhino von Siena und Peter Martyr von Florenz, ein Mitglied dieses edlen Vereins. Diese drei ausgezeichneten Toskaner haben, wie sie selbst durch Valdez in ihrer christlichen Erkenntnis weiter gefördert wurden, die Wirksamkeit des edlen Spaniers auf sehr segensreiche Weise unterstützt. Wenn Valdez vermöge seiner hohen Bildung und Lebensstellung von Gott vorzugsweise zum Lehrer und Seelsorger der durch Adel und Bildung Bevorzugten bestimmt zu sein schien, so waren diese drei Freunde und Gehilfen des außerordentlichen Mannes durch Beruf und Begabung dazu angewiesen, die im Kreise der „seligen Gesellschaft“ besprochenen evangelischen Wahrheiten der Gemeinde zu verkündigen. Namentlich erfüllte der berühmte Kapuzinergeneral Occhino, damals der gefeiertste Kanzelredner Italiens, diese Aufgabe in ausgezeichneter Weise. Wenn dieser hochgewachsene Mann, mit blassem, abgezehrtem Antlitz, schneeweißem Haupthaar und Bart, der bis an den Gürtel hinabreichte, während der Fasten die Kanzel bestieg und in der klangvollen toskanischen Mundart seine wundervolle Beredsamkeit zur Verherrlichung des Glaubens an Christum und eines ihm geweihten Lebens entfaltete, so strömte die ganze Bevölkerung Neapels nach dem Dome San Giovanni Maggiore, so dass die weiten Räume desselben die Zahl der Zuhörer nicht zu fassen vermochte. Als Kaiser Carl V. 1536 einer Predigt Occhinos in Neapel beigewohnt hatte, brach er in den Ausruf aus: „Wahrlich, dieser Mönch könnte Steine zu Tränen rühren.“ Ähnlichen Zulauf und Beifall ernteten Peter Martyr zu San Pietro ad aram und Giovanni Mollio zu San Lorenzo in ihren Vorträgen über die Briefe des Apostels St. Pauli. Eine wunderbare Zeit der Gnade war durch das vereinte Wirken dieser glaubensvollen evangelischen Männer für Neapel angebrochen. Giambattista Falengo schildert diese Erweckung mit dem begeisterten Ausruf: „Wahrhaft wunderbare Erscheinung unserer Tage! Frauen, deren Sinn gewöhnlich mehr zur Eitelkeit als zur Wissenschaft neigt, zeigen sich tief eingedrungen in die Wahrheiten des Heils, und Menschen in den niedrigsten Verhältnissen, selbst Soldaten zeigen uns ein Bild des vollkommenen christlichen Lebens. Jahrhundert! würdig des goldenen Zeitalters. Barmherziger Gott, welch eine reiche Ausgießung des heiligen Geistes!“
So entfaltete sich unter der Wirksamkeit dieser evangelischen Männer hier „auf diesem auf die Erde gefallenen Stück Himmels“ ein Geistesfrühling, welcher an Anmut und Wonne den Naturfrühling in diesem irdischen Paradies weit überstrahlte. Wenn aber hier der heiße Sirocco weht, so welkt augenblicklich die glühende Blütenpracht dahin, so dass die Blume des Feldes, die am Morgen noch Salomons Herrlichkeit überstrahlte, am Abend welk und versengt dasteht, ein sprechendes Bild der Vergänglichkeit des menschlichen Lebens. Ein ähnlicher versengender Glutwind kam auch über den Geistesfrühling, der damals in Neapel sich entfaltete, und bereitete demselben ein ähnliches Verderben, wie der Sirocco der Blütenpracht des Naturfrühlings.
5. Giovanni Mollio unter der Verfolgung der Theatiner und Jesuiten.
Das große Verderben, welches in der römischen Kirche herrschte und die nächste Veranlassung zur Reformation gegeben, wurde selbst von den eifrigsten Verteidigern des Papsttums anerkannt und bedauert. Statt aber eine Reformation der Kirche nach der Richtschnur des Wortes Gottes zu fördern oder wenigstens eine solche gewähren zu lassen, wollten die Eifrigsten unter den Verteidigern des Papsttums dem herrschenden Verderben steuern durch Belebung der alten Strenge gegen die Irrgläubigen, zu welchen sie die Evangelischen zählten, und durch Schärfung des Pflichteifers der Geistlichen in der Erfüllung ihrer kirchlichen Obliegenheiten. Unter den Männern, welche eine Reformation innerhalb der Schranken der Lehre und Einrichtungen der bestehenden päpstlichen Kirche durchführen wollten, nehmen die beiden Kardinäle Giampietro Caraffa und Gaetano da Thiene die ersten Stellen ein. Ersterer war ein aufbrausender, stürmischer Zelot, letzterer dagegen ein stiller, sanftmütiger, den Entzückungen eines geistlichen Enthusiasmus sich hingebender Mann. Diese beiden Männer sind die Stifter des für die Neubelebung und Erhaltung der päpstlichen Kirche, sowie für die Unterdrückung der evangelischen Erweckung sehr wirksamen Theatiner-Ordens. Auf die evangelische Bewegung in Neapel lenkten die Theatiner gleich ihre scharfe Aufmerksamkeit. Gaetano da Thiene begab sich selbst dahin und nahm Besitz von der San Pauls-Kirche, um von derselben aus dem Valdez und seinen Freunden entgegenzuwirken. Mit großer Eilfertigkeit und Entrüstung meldete darauf da Thiene seinem Freunde Caraffa, welche ketzerische Lehren in Neapel öffentlich verkündigt und verteidigt werden. Wie tief fühlten sich diese Eiferer verletzt durch Erscheinungen, wie sie Giannone, der Geschichtsschreiber Neapels, in folgender Weise schildert: „Diese neue Art der Predigt gibt, indem sie lebhaft die Geist bewegt, Gelegenheit zu häufigen Streitigkeiten über die heilige Schrift, über die Rechtfertigung durch den Glauben oder durch die Werke, über das Fegefeuer, und die bis dahin bloß den Theologen vorbehaltenen Fragen im Bereiche der Schulen traten nun in die Öffentlichkeit des Lebens. Sie wurden von Laien, ja selbst von Menschen ohne alle theologische Kenntnis und Gelehrsamkeit öffentlich besprochen. Ja man sah sogar geringe Handwerker von dem Gelüste ergriffen, über Gegenstände dieser Art zu sprechen, die Briefe des heiligen Paulus auszulegen, über die dunkelsten Punkte reden zu wollen; und die Ketzerei machte täglich neue Fortschritte, sich im Königreiche Neapel zu verbreiten, wie sie es in den meisten Gegenden Italiens bereits getan hatte.“ – Der Kardinal Caraffa, selbst Neapolitaner, beeilte sich den Vizekönig in einem Mahnschreiben vor den Feinden der Kirche in seiner Hauptstadt zu warnen und ihn zu ermahnen, dieselben sofort und mit allem Ernst zu unterdrücken. Inzwischen wurden die Gespräche der Mitglieder der „seligen Gesellschaft“ des Valdez, sowie die Predigten Occhinos und die Vorlesungen Martyrs und Mollios sorgfältig überwacht und auskundschaftet, und jede von der Kirchenlehre abweichende Äußerung sorgfältig bemerkt und nach Rom berichtet. Bis zum Jahre 1540 hatten die evangelischen Lehrer am päpstlichen Hofe ihre Beschützer und Verteidiger an den Kardinälen Contarini, Sadolet, Poole und Fregoso, aber mit diesem Jahr gestaltete sich ihre Lage immer düsterer und bedenklicher. Contarini ging als Legat zum Regensburger Gespräche und ward bald selbst am päpstlichen Hofe wegen seiner Nachgiebigkeit gegen die Protestanten verdächtigt. Valdez starb (1540) in Neapel tief betrauert von seinen Freunden, Occhino und Martyr verließen, müde der Verdächtigungen und Verfolgungen, diese Stadt, um bald durch Auswanderung nach der Schweiz ihr Leben und ihre evangelische Überzeugung zu retten. So befand sich noch Mollio allein von den ausgezeichneten evangelischen Lehrern in Neapel, um die kurz vorher so hoffnungsvoll aufblühende evangelische Gemeinde mit der Predigt des Evangeliums zu erbauen. Seine Beschützerinnen waren die Gräfin von Trajetto und Isabella Manrica, die auch zur „seligen Gesellschaft“ des Valdez gehörten. Letztere ward später selbst gezwungen, ihr Leben und ihre Überzeugung durch die Flucht nach der Schweiz zu retten. Mollios Stellung wurde besonders schwierig und gefährlich nach dem (1542) erfolgten offenen Übertritt Occhinos und Martyrs zur evangelischen Kirche der Schweiz, weil seine enge Verbindung mit diesen Männern bekannt war. Auf der anderen Seite vermehrten und verstärkten sich die Beschützer und Verteidiger der päpstlichen Kirche immer mehr, indem sie zugleich immer heftiger die Evangelischen befeindeten und verfolgten. Neben den Theatinern und zum Teil nach dem Vorbild dieses Ordens organisierte Ignatius Loyola in Venedig die Compagnie Jesu, die vom Papste 1540 bedingt und 1543 unbedingt als ein eigener Orden bestätigt wurde. Auf eifriges Eindringen des Kardinals Caraffa, der dabei vom Kardinal von Burgos, Juan Alvarez von Toledo, sowie von Ignatius Loyola unterstützt wurde, beschloss der Papst die Einführung der Inquisition (21. Juli 1542) zur Unterdrückung der Ketzerei, das heißt, der evangelischen Richtung und Lehre. Furchtbar war namentlich in Neapel die Betätigung aller dieser in einander greifenden Anstalten und Maßnahmen zu ihrer Unterdrückung. Die von den Seggi gestiftete Akademie ward unterdrückt, die frömmsten Christen, die nicht flüchtig ihr Vaterland verließen, eingekerkert und durch das Inquisitionstribunal zum Feuertod verurteilt. Auch Mollio musste 1548 Neapel verlassen, um von nun an zehn Jahre hindurch von der Inquisition und ihren Trabanten, den Theatinern und Jesuiten, umspäht, verfolgt und eingekerkert zu werden. Geronymo Mariano meldete 1544 dem Professor Pellican in Zürich, dass Mollio von Montalcino, der Regens eines Klosters von Mailand, um seines evangelischen Bekenntnisses willen in Gefangenschaft gehalten werde.
6. Giovanni Mollio vor dem Inquisitionstribunal und sein seliges Ende.
Endlich ward Mollio 1453 auf Befehl Julius III. (1540-55) in Ravenna ergriffen und fest verwahrt nach Rom geführt. Während seiner mehrere Monate dauernden Gefangenschaft beendigte er einen Kommentar über die Genesis, der gelobt wird. Den 5. Sept. 1553 wurde in der Kirche St. Maria di Menava mit großem Pomp ein öffentliches Inquisitionsgericht über ihn und einige seiner Schüler gehalten.
Leider verstanden sich die meisten von den letzteren, um ihre Leben zu fristen, zum Widerruf der früher bekannten evangelischen Lehre. Nur der treue Tisserano von Padua blieb bis zum Tod seinem Lehrer und der von ihm verkündigten evangelischen Wahrheit treu. Vor das Inquisitionstribunal, das aus sechs Kardinälen und mehreren Bischöfen bestand, erschien Mollio, mit der ihm dargereichten brennenden Fackel in der Hand, mutigen und festen Sinnes und verteidigte mit der größten Freimütigkeit die von ihm verkündigte evangelische Wahrheit. In seiner Verteidigungsrede behandelte Mollio seine Richter als ein Mann, der keine irdische Rücksicht mehr kennt. „Der Papst,“ sagte er unter anderem, „ist keineswegs der Nachfolger Christi oder des Apostels Petri oder das Haupt der christlichen Kirche, sondern vielmehr der wahre Antichrist, ein verfluchter und verdammter Fürst des antichristlichen Reiches, der sich mit gleichem Recht die tyrannische Herrschaft über die Kirche angemaßt, mit dem der Raubmörder seine unschuldigen Opfer erwürgt. Was Euch, Ihr Kardinäle und Bischöfe, betrifft, so habt Ihr die Gewalt, die Ihr Euch anmaßt, nicht durch ehrliche Mittel erlangt, sondern vielmehr durch ehrgeizige und verwerfliche Umtriebe. Darum kennt Ihr weder Maß noch Zucht, noch achtet Ihr irgend Tugend und Ehrbarkeit. Darum muss ich auch härter mit Euch reden, dass Eure Kirche nicht Gottes, sondern des Satans Kirche sei und das echte Babel. Wenn Eure Gewalt, wie Ihr es Vorgebet, von den Aposteln herstammte, so würde auch Eure Lehre mit derjenigen der Apostel und Eure Lebensweise mit der ihrigen übereinstimmen. Nun aber findet gerade das Gegenteil statt. Ihr verachtet und verstoßt auf die frevelhafteste Weise den Herrn Jesum Christum und sein Wort. Ihr glaubet nicht wahrhaftig, dass ein Gott im Himmel sei. Ihr verfolget und tötet Gottes treue Diener und löst seine Gebote auf. Ihr beraubt die armen Gewissen ihrer Freiheit und unterdrückt sie. Ihr maßt Euch tyrannischer Weise Gewalt über zeitliches und ewiges Leben und Tod an. Darum appelliere ich vor diesem Eurem Gericht und fordere Euch auf den jüngsten Tag vor den Richterstuhl Christi. Da werdet Ihr, es mag Euch lieb oder leid sein, von Eurem Tun und lassen genaue Rechenschaft ablegen müssen; und wenn Ihr nicht vorher Buße tut, so müsst Ihr ewig im höllischen Feuer brennen. Zum Zeugnis dieser Warnung nehmt diese brennende Fackel zurück, die Ihr mir in die Hand gegeben.“ Mit diesen Worten warf er entrüstet dieselbe vor die Füße seiner Richter. Die Kardinäle und Bischöfe knirschten mit Zähnen und schrien, man solle diesen Menschen aus ihren Augen entfernen. Hierauf ward über ihn und über seinen Schüler Tisserano das Urteil gesprochen, dass sie zuerst erwürgt und sodann ihre Leichname verbrannt werden sollen. Bei Anhörung dieses Urteils erhob Mollio seine Augen gen Himmel und sprach: „O Jesus Christus, mein Herr und Heiland, mein oberster Priester und mein getreuer Hirte! Auf der ganzen Welt gibt es nichts, an dem ich mehr Gefallen hätte, als dass ich um Deines Namens willen mein Blut vergießen soll.“
Hierauf wurden sie auf den Campo Fiore hinausgeführt, wo Tisserano zuerst gehenkt wurde, nachdem er noch für seine Feinde gebetet hatte. Mollio dankte noch Gott vor seinem Tod für die unaussprechliche Gnade, dass Er ihn zum Licht seines Wortes geführt und ihn zum Zeugen seines Evangeliums erwählt habe. Hierauf ward er gehenkt und sein Leichnam mit demjenigen des Tisserano sodann verbrannt. So ward dieser treue Diener Christi gewürdigt, seinen Glauben an den Heiland durch den Märtyrertod zu besiegeln. „Wer aber Christo getreu ist bis an den Tod, dem will Er die Krone des Lebens geben.“ (Off. 2,10.)
Der Franziskanerorden, dessen Mitglied Mollio gewesen, wurde einer strengen Untersuchung unterworfen, in Folge welcher noch Mancher, der demselben angehörte, die Flucht ergreifen oder in den Gefängnissen der Inquisition verschmachten musste. Auf päpstlichen Befehl wurde hierauf sämtlichen Professoren dieses Ordens verboten, die Bibel zu erklären. Nur die Werke des großen Meisters ihres Ordens, Duns Scotus, sollten sie ihren Vorlesungen zu Grunde legen. Aber „Gottes Wort ist dennoch nicht gebunden,“ (2. Tim. 2,9) wenn auch die treuen Verkündiger desselben um seinetwillen Gefängnisse und Banden erdulden und tragen müssen. „Selig aber sind die Gottes Wort hören und bewahren.“ Luc. 11,28.