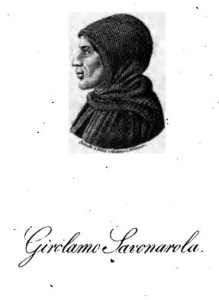Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg.

Elisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg. geb. 1510. gest. 1559. Joachim I. war noch ein Jüngling von 16 Jahren, als er im Jahre 1499 Kurfürst von Brandenburg wur-de. Nach Geist und Körper ausgezeichnet, gelehrt wie nicht leicht ein Fürstensohn, den Künstlern hold,… WeiterlesenElisabeth, Herzogin von Braunschweig-Lüneburg.